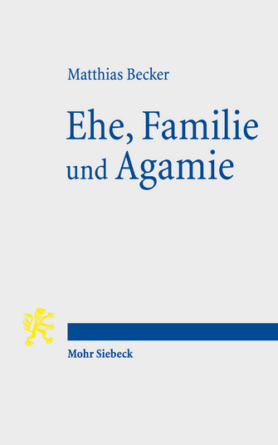Matthias Becker: Ehe, Familie und Agamie. Die Begründung von Lebensformen angesichts gesellschaftlicher Pluralität im Neuen Testament und heute
Matthias Becker: Ehe, Familie und Agamie. Die Begründung von Lebensformen angesichts gesellschaftlicher Pluralität im Neuen Testament und heute, Tübingen: Mohr Siebeck, 2024, Br., X+239 S., € 29,–, ISBN 978-3-16-162542-8
Matthias Becker ist promovierter Gräzist und nach Promotion und Habilitation in Theologie (habilitiert in Göttingen 2019) seit 2020 ordentlicher Professor für Neutestamentliche Theologie an der Universität Heidelberg. Mit seiner doppelten Expertise analysiert Becker, welche Begründungen vor dem zeitgenössischen Hintergrund in den neutestamentlichen Diskursen zu Ehe, Familie und Ehelosigkeit besonders relevant sind, und er setzt seine Ergebnisse in Beziehung zu den gegenwärtigen Debatten um diese Themen.
Die Studie folgt einem dreiteiligen Aufbau. Teil 1 stellt die Pluralität der Lebenswelt im Römischen Reich mit ihren unterschiedlichen Ehe-, Familien- und Sexualdiskursen dar (1–42). Der Hauptteil nimmt die Begründungen der verschiedenen neutestamentlichen Autoren für Ehe, Familie und Ehelosigkeit in den Blick (43–162). In Teil 3 werden hermeneutische Impulse für die gegenwärtigen Debatten über Lebensformen in Theologie und Kirche formuliert (163–191).
Unter der Überschrift „I. Lebensformen im Kontext“ skizziert Becker mit zahlreichen Referenzen auf griechische und lateinische Texte des 1. Jh. v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr. (u. a. Epiktet, Plutarch, Martial, Musonius Rufus, Sueton, Tacitus) sowie im Gespräch mit der klassisch-philologischen und historischen Forschung die Pluralität der Lebensformen und Sexualität in der antiken Gesellschaft. Becker stellt in methodischer Hinsicht klar, dass die antike Literatur nicht unbedingt einfach nur die sozial-historischen Verhältnisse abbildet, sondern von anderen Interessen geleitet gewesen sein kann, dass andererseits die Texte gleichwohl „als Zeitzeugen jeder paganen Mehrheitsgesellschaft zu lesen“ (41) sind, die sexual- und familienethisch heterogen war und in der die neutestamentlichen Autoren ihre Schriften verfassten. Becker zeichnet ein Bild einer antiken multiethnischen, multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft, in der ähnliche Themen und Lebensformen wie in unserer heutigen präsent waren, u. a. Ehe auf Grundlage von Liebe, Scheidungen, außereheliche Beziehungen, Patchworkfamilien, unverheiratetes Zusammenleben, homosexuelle Partnerschaften auf Augenhöhe, Bisexualität, Transsexualität, Diskurse um homosexuelle Veranlagung und um sexuelle Orientierung.
In Teil II bietet Becker einen empirischen Durchgang durch die Schriften des Neuen Testaments, gegliedert nach den Autoren (Paulus, Evangelien bzw. Jesus, Deuteropaulinen, Pastoralbriefe, Hebräer, 1. Petrus, Apokalypse). Die einschlägigen Stellen zu Ehe, Familie und Agamie werden gründlich analysiert und auf ihre in Anspruch genommenen Begründungsinstanzen hin befragt. Wenige Beispiele seien an dieser Stelle genannt:
Nach Becker schildert Paulus Ehe als „Anti-Lebensform“ (44) zu den diversen Ausprägungen von πορνεία. Unter dem Begriff porneia verstehe Paulus „außerehelichen Geschlechtsverkehr“ sowie „homoerotische Sexualhandlungen“ (44).
In 1Thess 4,1.3 verwendet Paulus „eine theozentrische Begründungsstrategie der Ehe- und Sexualethik“ (48), wenn er dazu mahnt, Gott zu gefallen (V. 1), und wenn er auf den Willen Gottes rekurriert (V. 3). Mit der Gefäßmetapher (V. 4) umschreibe Paulus eine respektvolle Sexualität und einen wertschätzenden Umgang in der Ehe. Ob vor dem Hintergrund der Vorstellung von Gott als Töpfer damit zugleich „Ehe als Resultat einer göttlich beeinflussten Partnerzuteilung“ (53) gedacht ist, bleibt jedoch kritisch zu hinterfragen.
In 2Kor 6,14–7,1 und 1Kor 7,10f begründe Paulus auch mit einem Kyriosrekurs die Lebensform der Ehe zwischen zwei christlichen Partnern, deren Scheidung grundsätzlich untersagt sei, sowie die Lebensform der Ehelosigkeit, wobei er für Letztere wegen der stärkeren Fokussierung auf den Kyrios besonders werbe (64–68).
In Mk 10,2–12 begründe Jesus ein Verständnis „der Ehe als eines grundsätzlich unverbrüchlichen Bundes“ (91), das durch die Schrift (Gen 2,24) inspiriert sei.
In Eph 5,22–33 wird mit Kyriosrekursen und einem (schöpfungstheologischen) Schriftzitat argumentiert. Becker stellt dabei heraus, dass hier nicht ein Patriarchat, sondern ein Christusarchat vertreten wird, weil beide Ehepartner Geliebte und Untergebene Christi seien (111).
Ein thesenartiger Überblick der Begründungsrekurse für Ehe und Familie einerseits und Ehelosigkeit andererseits fasst den Hauptteil zusammen (151–160). Insgesamt zeigt Becker, dass theozentrischen, christusfokussierten und schriftbezogenen Begründungen die entscheidende Rolle zukommt.
In dem Schlusskapitel gibt Becker hermeneutische Impulse für Theologie, Kirche und Lebensformen heute. Die Quintessenz ist dabei, dass die theozentrischen, christusfokussierten und schriftbezogenen Begründungen des Neuen Testaments auch heute noch relevant sind, zumal hinsichtlich der Pluralität der Lebensformen und der sexuellen Vielfalt die Verhältnisse in der Entstehungszeit des Neuen Testaments denen in der unsrigen Zeit „nicht ganz unähnlich“ (172) sind. Becker konstatiert für das Neue Testament, dass es für die Glaubenden nur „für die monogame Ehe zwischen einem Mann und einer Frau… sowie für eine auf Sexualität verzichtende Ehelosigkeit“ (174) eintritt. Und dies werde letztlich mit der Gotteslehre und Christologie und gerade nicht mit gesellschaftlichen Konventionen begründet. Diesen Grundansatz hält Becker angesichts der vergleichbaren antiken und aktuellen Diversität der Lebensformen für weiterhin wegweisend und plädiert in den ehe-, familien- und sexualethischen Diskursen für ein Festhalten an den neutestamentlichen Begründungsrekursen auf Gott, Christus und die Schrift (174f). In den heutigen Debatten sei zu berücksichtigen, dass sich das Neue Testament selbst schon mit ehe- und sexualethischer Pluralität auseinandersetzen musste und dass die neutestamentlichen „Aussagen über Ehe, Familie und Ehelosigkeit auch die innerbiblische Hermeneutik, die Christologie und die christliche Gotteslehre betreffen… Theozentrische, christusorientierte und schriftbezogene Gründe sind in jeder Ausprägung und gesellschaftlicher Diversität relevant – im 1. Jahrhundert ebenso wie heute.“ (190).
Ein Stellen-, ein Namens- und ein Sachregister sind beigefügt, mit Hilfe derer sich sehr gut relevante Informationen erschließen lassen.
Die Lektüre von Beckers Studie ist äußerst lohnend, weil diese ein fundiertes Bild der antiken Gesellschaft zeichnet und damit das Potenzial hat, die gegenwärtigen sexualethischen Debatten auf eine solide Basis hinsichtlich des historischen Umfelds des Neuen Testaments zu stellen. Zugleich arbeitet Becker durch die Exegese der einschlägigen neutestamentlichen Stellen hermeneutisch reflektiert deren Beitrag für heutige Diskurse heraus. Die Begründung sexualethischer Positionen in der Gegenwart kann von der Rezeption von Beckers Studie und der kritischen Reflexion der von ihm herausgearbeiteten neutestamentlichen Begründungsrekurse enorm profitieren und so an Profil gewinnen.
Dr. Detlef Häußer, Professor für Neues Testament an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg