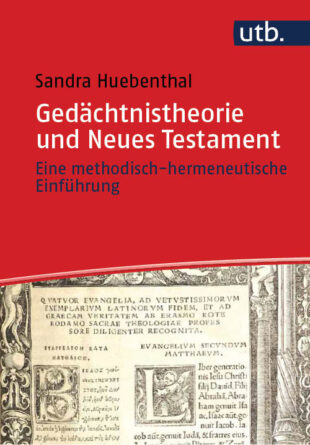Sandra Huebenthal: Gedächtnistheorie und Neues Testament
Sandra Huebenthal: Gedächtnistheorie und Neues Testament. Eine methodisch-hermeneutische Einführung, utb 5904, Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2022, Pb., 371 S., € 26,90, ISBN 978-3-8252-5904-4
Sandra Huebenthal, Professorin für Exegese und Biblische Theologie an der geistes- und kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Passau, fasst mit diesem Buch die Ergebnisse mehrerer universitärer Veranstaltungen zusammen. Ihr Anliegen ist es, Erkenntnisse der kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie in die Exegese des Neuen Testaments miteinzubeziehen.
Im ersten Hauptteil erläutert Huebenthal die hermeneutische Grundlegung und Methodik ihrer Darstellung. Sie stellt fest, dass es mit dem Begriff der Erinnerung in der Antike nicht um das geht, was geschehen ist, sondern darum, wie etwas Vergangenes in der jeweiligen Gegenwart verstanden wurde (18). Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ergebe sich, dass Erinnerung den aktiven Prozess des Entstehens von Erinnerungen meint, während sich Gedächtnis auf den bestimmten Zustand und die Struktur einer Erinnerung zu einem bestimmten Zeitpunkt bezieht (21). Im Anschluss nimmt die Autorin die Vorstellungen eines sozialen, kollektiven und kulturellen Gedächtnisses auf. Während das soziale Gedächtnis noch in einem unmittelbaren Bezug zur Vergangenheit stehe, habe sich das kollektive Gedächtnis etwas weiter davon entfernt. Im Unterschied zum sozialen Gedächtnis zeichne sich das kollektive Gedächtnis außerdem dadurch aus, dass es bewusst geformt und weitergegeben werde. Für das kulturelle Gedächtnis liege die Vergangenheit weit zurück und werde durch eine vorgegebene Tradition erlebt (57). Der Wandel von einer Gedächtnisart zur Nächsten kommt durch Generationenwechsel, Krisenerfahrungen und Medienwechsel zu Stande, so Huebenthal. Im Anschluss zieht die Autorin erste Schlussfolgerungen für das Verständnis der ntl. Schriften: Zum einen ordnet sie die neutestamentlichen Schriften den Gedächtnisarten (sozial, kollektiv oder kulturell) zu und diskutiert in diesem Zusammenhang vor allem die Auswirkungen von Krisenerfahrungen auf die Entstehung der Schriften. Zum anderen stellt Huebenthal dar, welche exegetischen Methodenschritte sich aus einer kulturwissenschaftlichen Lektüre biblischer Texte ergeben (Erzähltextanalyse, Analyse der Erzählinstanz, Beziehungsgeflecht von Erzähler und Leser, Motivanalyse).
Der zweite Hauptteil wendet die im ersten Kapitel erarbeiteten Methodenschritte auf sechs Schriften des Neuen Testaments an. So untersucht die Autorin beispielsweise das Markusevangelium und beschränkt sich hierbei vor allem auf Mk 1,1-3,6. Auf eine erste Darstellung der Struktur des Markusevangeliums folgen Ausführungen zu seinen Erzählgattungen. Ein etwas umfassenderer Teil ist dem Anfang des Evangeliums gewidmet (Mk 1,1-15). Huebenthal zeigt anhand diverser Stichwortverbindungen zum AT, dass Markus vor allem ein jüdisches kulturelles Gedächtnis voraussetzt, auch wenn es vereinzelte Anknüpfungspunkte für heidnische oder bereits getaufte Leser gibt (176-177). Insgesamt ist das Markusevangelium Zeugnis eines kollektiven Gedächtnisses, so Huebenthal. Es hat nicht mehr die Nähe zu den Ursprungsereignissen wie dies im Falle eines sozialen Gedächtnisses wäre. Markus unternehme den bewussten Versuch, die Jesusgeschichte so zu erzählen, dass die Adressatengemeinde darauf ihre Identität gründen kann. Sämtliche von Huebenthal im zweiten Kapitel analysierten Schriften haben gemeinsam, dass es in ihnen um eine Identitätsbestimmung der Adressatengemeinde geht. Die Identitätsbestimmung werde dadurch ermöglicht, dass das soziale oder kollektive Gedächtnis der Adressaten in Beziehung gesetzt wird zu ihrem jüdischen kulturellen Gedächtnis (248-250).
Im dritten Hauptteil geht Huebenthal der Frage nach, wie eine kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie andere bibelwissenschaftliche Teildisziplinen geprägt hat und prägen kann (251). Die historische Jesusforschung beispielsweise habe dank der kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie einen zweifachen Paradigmenwechsel hinter sich: den Wechsel vom historischen zum erinnerten Jesus (Jesus Remembered) und den Wechsel, die Evangelien nicht nur als Erinnerungen an die Vergangenheit, sondern als in ihrer Gegenwart vollzogene Identitätsbildung zu lesen (253-257). Außerdem könne die kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie weiter dabei helfen, Entstehungsszenarien ntl. Schriften zu beleuchten (285). Mit Blick auf die sog. „Flavierthese“ und die Entstehung des Markusevangeliums helfe die kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie beispielsweise, zwischen dem Rezeptionspotential eines Textes und seinen Produktionsbedingungen zu unterscheiden. So ist es nach Huebenthal denkbar, das Markusevangeliums am Ende des ersten Jahrhunderts vor dem Hintergrund des Aufstiegs der flavischen Dynastie als imperiumskritisches Anti-Evangelium zu lesen. Äußerst unwahrscheinlich sei es jedoch, dass Markus Anfang der 70er Jahre des ersten Jahrhunderts sein Evangelium bewusst als Gegengeschichte zum römischen Imperium und der flavischen Herrschaft geschrieben hat.
Huebenthal bietet im ersten Hauptteil ihrer Monographie eine gut lesbare Orientierung im interdisziplinären Feld von kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorie und Neuem Testament. Der zweite und dritte Hauptteil konzentriert sich auf die Folgen dieses Ansatzes für die Arbeit mit dem Neuen Testament und enthält manch überraschende Einsichten, wenn man bereit ist, die ntl. Schriften als Gedächtnistexte zu lesen. Manches im Buch ist erklärungsbedürftig: 1) Titel und Untertitel des Buches sind etwas irreführend. Man erwartet möglicherweise eine Einführung in die Gedächtnistheorie und das Neue Testament, erhält aber eine Einführung in die kulturwissenschaftliche (!) Gedächtnistheorie und das Neue Testament. Forschungen zum Gedächtnis aus dem Bereich der kognitiven Psychologie wurden und werden in der ntl. Wissenschaft rezipiert, spielen in diesem Buch jedoch keine Rolle. 2) Die Anordnung der einzelnen Kapitel im zweiten und dritten Hauptteil ist verwirrend. Nachdem der zweite Hauptteil gegen Ende eine exemplarische Lektüre ntl. Texte vor dem Hintergrund kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorie bietet, wendet sich auch der dritte Hauptteil den Folgen für die ntl. Lektüre zu. Dabei ist nicht immer ersichtlich, warum die Textbeispiele ausgerechnet im zweiten bzw. im dritten Hauptteil vorkommen. 3) Manche im Buch dargestellten Methodenschritte klingen im Rahmen des Buches wie eine neue Errungenschaft, sind aber bereits Teil des exegetischen Methodenkanons. So wird beispielsweise die Erzähltextanalyse auch ohne ausdrückliche Verortung in der kulturwissenschaftlichen Gedächtnistheorie längst gewinnbringend in der Exegese berücksichtigt. 4) An manchen Stellen behauptet Huebenthal etwas, ohne den m. E. überzeugenden Nachweis zu erbringen. So geht sie beispielsweise in ihrer Darstellung des Erinnerungsbegriffs in der Antike zu Beginn des Buches zu schnell dazu über, Gedächtnis und Erinnerung als hermeneutische und nicht als historische Kategorie zu verstehen. Trotz dieser kleineren Vorbehalte bleibt das Buch für jene unumgänglich, die das Neue Testament aus der Perspektive kulturwissenschaftlicher Gedächtnistheorie lesen wollen.
Dr. Torben Plitt, Pastor FeG Bad Endbach