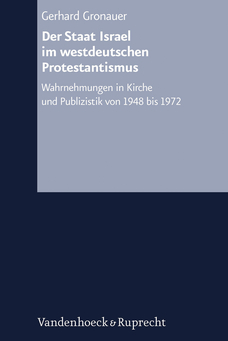Gerhard Gronauer: Der Staat Israel im westdeutschen Protestantismus
Gerhard Gronauer: Der Staat Israel im westdeutschen Protestantismus. Wahrnehmungen in Kirche und Publizistik von 1948 bis 1972, AKZG.B 57, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, geb., 518 S., € 120,–, ISBN 978-3-525-55772-3
Gerhard Gronauer, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, beleuchtet in der überarbeiteten Version seiner Erlanger Dissertation von 2008 das Verhältnis des westdeutschen Protestantismus zum Staat Israel von seiner Gründung bis zur Zeit vor dem sog. Yom-Kippur-Krieg 1973.
Wenige Jahre nach dem Ende der Verfolgung und Vernichtung von Millionen jüdischer Menschen war 1948 der zionistische Traum von einem unabhängigen jüdischen Staatswesen im Land der Väter in Erfüllung gegangen. Dieses Ereignis löste unter Protestanten in Deutschland höchst unterschiedliche Reaktionen aus. Für viele Protestanten war die Entstehung eines solchen Staatswesens gemäß ihren theologischen Überzeugungen nicht vorgesehen. 1952, kurz vor seinem Tod, erklärte der ehemalige Direktor der Basler Mission Karl Hartenstein (* 1894): „Gott wird dieses Volk heimbringen, nicht in das irdische Palästina, sondern in das himmlische Jerusalem und zu dem lebendigen Christus und in das kommende Reich.“ (81). Ganz anders Kurt Scharf (1902–1990), der spätere Ratsvorsitzende der EKD: „Im Sommer 1948 nannte er die soeben erfolgte ‚Wiedergeburt der Nation Gottes‘ das ‚augenfälligste ‚Zeichen der Zeit‘‘, das er nur ‚prophetisch-apokalyptisch‘ zu deuten wusste.“ (372).
Gronauer lässt aus der Frühzeit des Staates Israel einerseits einen Vertreter eines judenmissionarischen Werkes zu Wort kommen, andererseits einen Vertreter einer auf Dialog angelegten Neubestimmung des Verhältnisses von Juden und Christen:
In der Zeitschrift „Friede über Israel“ antwortete 1953 Wilhelm Grillenberger (1911–1998) auf die Frage: „Was bedeutet für uns Christen die Gründung des Staates Israel?“ Darin stellte er eine auf Hesekiel 34 bezogene rhetorische Frage zur Wiederbesiedlung des Landes Israel durch das jüdische Volk: „Hat der gute Hirte Jesus sie hinaufgeführt? Nein, sie sind ohne ihn gegangen. Sie wollen auch ihr Land ohne ihn wieder aufbauen.“ Grillenberger verwies auf den Artikel 17 der Augsburgischen Konfession, wonach dem jüdischen Volk kein irdisches, sondern nur ein zukünftiges himmlisches Reich verheißen sei. An anderer Stelle findet sich bei Grillenberger die folgende zugespitzte Formulierung: „Es ist irreführend, wenn dem Volke Israel in Aussicht gestellt wird, es werde das Heil in der Form erleben, daß Jesus sie wieder ins heilige Land zusammenführt. […] Als Jesus gekreuzigt wurde, starb mit ihm das nationaljüdische Messiasbild.“ (87). Einen positiven Aspekt sah Grillenberger in der Entstehung des Staates Israel, insofern sich damit neue Möglichkeiten für die Judenmission eröffnen könnten: „Vielleicht wird jetzt erst die Grundlage dafür entstehen, dass eine jüdische Volkskirche in hebräischer Sprache gegründet werden kann.“ (88). Vertreter der judenmissionarischen Werke verfolgten mit Wohlwollen beispielsweise das Werden der evangelisch-lutherischen Elias-Kirchengemeinde in Haifa, wo sich jüdische Menschen versammelten, welche in Jesus von Nazareth den Messias Israels erkannt hatten. Der dortige Gemeindeaufbau geschah vor allem mit Unterstützung durch die norwegische Israel-Mission. Dieser war schon in den Jahren nach 1948 der Zugang nach Israel möglich – anders als Missionswerken aus Deutschland. Inzwischen hat jene Gemeinde längst ihren Namen geändert in „Beit Eliyahu“; sie versteht sich als jüdisch-messianische Gemeinde ohne Konfessionsbindung, offen auch für nicht-jüdische Glieder.
1950 konnte der Heidelberger Kreisdekan Hermann Maas (1877–1970), der auf Grund seines Widerstands gegen die nationalsozialistische Judenverfolgung das Vertrauen von Regierungsvertretern besaß, den jungen Staat Israel besuchen. Gronauer stellt dazu zusammenfassend fest: „Der Israeli wurde in den Reiseberichten als der fleißige Arbeiter und Bauer geschildert, der Sümpfe trocken lege und die Wüste zum Leben erwecke sowie in den Kibbuzim die ideale Gesellschafts- und Wirtschaftsform entwickelt habe. Damit sollte bewusst den tradierten antisemitischen Klischees entgegengearbeitet werden. Bei Maas kam auch noch die heilsgeschichtliche Komponente hinzu. Sowohl in der israelischen Staatsgründung als auch in den boomenden Städten und den ertragreichen Feldern erkannte er die Erfüllung biblischer Verheißungen.“ (372).
Gronauer berichtet auch vom Einsatz engagierter Protestanten zugunsten einer finanziellen Entschädigung Israels für die nur wenige Jahre zurückliegenden Verbrechen an jüdischen Menschen. Der schon erwähnte Hermann Maas wandte sich in der Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages und setzte sich ein für das 1952 ausgehandelte Luxemburger Abkommen, das einer faktischen Anerkennung Israels durch die (west-)deutsche Bundesregierung gleichkam. Maas wusste um die verbreiteten Vorbehalte in der Bevölkerung gegenüber Zahlungen an Israel und war in seiner Wortwahl deutlich: „Reden Sie nicht von unseren Nöten. Wir haben sie verdient.“ (124). Otto von Harling von der EKD-Kirchenkanzlei dagegen begründete die Zurückhaltung der Evangelischen Kirche in Deutschland in dieser Angelegenheit so: Diese „mußte ja auch die seelische und wirtschaftliche Lage des Volkes, zu dem sie sprach, im Auge haben, wenn sie nicht völlig in den Wind reden wollte.“ Gronauer kommentiert: „In von Harlings Ausführungen manifestierte sich ein Selbstbild von einer Kirche, die sich primär als Seelsorgerin an der Bevölkerung und weniger als eine moralische Kraft betrachtet, welche mit Verve neue Themen vorantreibt.“ (125).
Ende der fünfziger Jahre beginnend, nahmen mehr und mehr Kirchenmitglieder – insbesondere Theologen – die Möglichkeit wahr, den Staat Israel zu besuchen. Der Berliner Professor für systematische Theologie Helmut Gollwitzer (1908–1993) bekannte rückblickend – so Gronauer –, „dass Jerusalem weder eine rein ‚himmlische‘ Größe war wie in der traditionellen christlichen Theologie noch eine bloße Stätte biblischer Altertümer darstellte wie in der klassischen Exegese: ‚Damals erfaßte ich sinnlich, daß Jerusalem eine Stadt auf Erden ist‘, ein heutiger Ort lebendigen Judentums.“ (129). Noch war Jerusalem geteilt in die israelische Neustadt und die zu Jordanien gehörende Altstadt. Dennoch war es einer Studentengruppe aus Berlin mit ihrem Pfarrer Rudolf Weckerling (1911–2014) möglich, über Libanon, Syrien, Jordanien nach Jerusalem zu reisen. Auffallend erscheint Weckerlings Plädoyer gegenüber einem einseitigen Schuldgefühl gegenüber dem jüdischen Volk, weil Deutsche „Schuldner der Araber wie der Juden sind, denn ohne den Versuch der ‚Endlösung‘, d. h. der völligen Ausrottung der Juden in Europa, wäre der Staat Israel nicht unter denselben Umständen entstanden und hätte das arabische Flüchtlingsproblem nicht diese Ausmaße angenommen.“ (131).
Wie schon beim Einsatz zugunsten einer Entschädigungs-Regelung in den fünfziger Jahren waren es zunächst einzelne engagierte Protestanten, welche sich in den frühen sechziger Jahren für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel einsetzten. Die Bundesregierung zögerte lange, diesen Schritt zu tun, da man befürchtete, die arabischen Staaten könnten im Gegenzug zur Anerkennung Israels durch die Bundesrepublik ihrerseits die DDR anerkennen. Für eine Fürsprache bei der Bundesregierung zugunsten eines Botschafter-Austauschs sollte der hessen-nassauische Kirchenpräsident Martin Niemöller (1892–1984) gewonnen werden – renommierter Vertreter der Bekennenden Kirche während der Herrschaft der Nationalsozialisten. Dieser lehnte ab: „Dass sich die Araber durch die Schaffung eines jüdischen Staates in der Mitte der arabischen Welt… gefährdet und attackiert sehen, das kann ich ihnen nicht übel nehmen. Und ich glaube nicht, dass unsere deutsche Schuld gegenüber den Juden durch die Unterstützung des Staates Israel in irgendeiner Weise geringer wird… Inwiefern aber die Evangelische Kirche eine positive Aufgabe… am Staat Israel haben soll oder darf, das ist mir bis zur Stunde schleierhaft.“ (182). Eine gegensätzliche Haltung vertrat Helmut Gollwitzer, welcher der Bundesregierung eine einseitige pro-arabische Ausrichtung vorwarf und auf das zahlenmäßige Missverhältnis zwischen der arabischen Welt einerseits und damals zweieinhalb Millionen Israelis andererseits verwies. Gronauer fasst Gollwitzers Haltung so zusammen: „Indem Gollwitzer Sacharja 2,12 zitierte – Israel als Gottes Augapfel –, drohte er der Bundesregierung indirekt mit dem Gericht Gottes.“ (183).
Einen Einschnitt in den Beziehungen der EKD zum Staat Israel brachte der sogenannte Sechstagekrieg 1967 mit sich, als der junge Staat von den Armeen seiner Nachbarstaaten eingekreist war und als Ergebnis der kriegerischen Handlungen große Gebietsgewinne erzielte. Während jener Tage fanden ungezählte Fürbitte-Gottesdienste in westdeutschen evangelischen Kirchen statt. Kirchenleiter äußerten sich durchaus gegensätzlich. Der EKD-Ratsvorsitzende Hermann Dietzfelbinger (1908–1984) rief zur Fürbitte für alle damals vom Krieg betroffenen Völker auf. Seine Sorge galt nicht speziell dem bedrohten Staat Israel, sondern der Tatsache, „daß die Stätten der biblischen Geschichte, an denen Jesus Christus den Menschen den Frieden Gottes offenbar gemacht hat, erneut in Kriegsgeschehen hineingezogen werden.“ (203). In einem evangelisch-katholisch-jüdischen Gottesdienst ergriff Kurt Scharf, inzwischen Bischof der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, in seiner Fürbitte Partei zugunsten Israels: „Die arabischen Nachbarn Israels… bestreiten das Lebensrecht der Juden in Palästina. Das jüdische Volk, kaum daß es sich wieder in Palästina gesammelt hat, soll erneut dem Untergang überantwortet werden. Wir flehen dich an für Israel: Stelle den Frieden her an seinen Grenzen.“ (204). Unter dem Eindruck des Kibbuz-Aufenthalts einer Gruppe der evangelischen Landjugend in Bayern bot deren Landespfarrer an, Kinder aus jenem Kibbuz im Fall einer Eskalation des Konflikts in Bayern aufzunehmen.
Dass Israel im Gefolge der Eroberung von Gebieten jenseits der Waffenstillstandslinien von 1949 zunehmend als Besatzungsmacht wahrgenommen und kritisiert wurde, machte auch vor politisch engagierten Protestanten nicht Halt, beispielsweise bei den Evangelischen Studentengemeinden . Über deren Haltung urteilt Gronauer: „Während diese einst begeisterte Israelfahrer waren und für den deutsch-israelischen Botschafteraustausch eintraten, wurden nun auch hier vermehrt israelkritische Stimmen laut.“ (223). Der Vorwurf an Israel, imperialistisch zu handeln, wurde vielfach erhoben. Gronauer untersucht zahlreiche kirchliche Publikationen aus dem evangelischen Bereich und kam zu dem Schluss: „Die Texte, die in Israels Kriegen expansionistische Aggressionen zu erkennen meinten, nahmen zu. Das Argument, der jüdische Staat würde sich nur verteidigen, war im Zuge des Sechstagekrieges weniger glaubhaft geworden.“ (397). Hierzu ein weiteres Zitat: „Das süffisante Wortspiel, dass die nationale Orientierung der sozialistischen israelischen Arbeiterpartei zu einem ‚Nationalsozialismus‘ führe, diskreditierte die Israelis als Nazis der Neuzeit.“ (ebd.).
Seit 1961 bemühte sich die Arbeitsgemeinschaft „Christen und Juden“ bei den evangelischen Kirchentagen darum, den Jahrhunderte alten kirchlichen Anti-Judaismus zu überwinden. Zu den dort behandelten Themen gehörte auch die Haltung der Christenheit zum Staat Israel und zum Nahost-Konflikt. Beim Stuttgarter Kirchentag 1969 brach Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928–2002), Helmut Gollwitzers Nachfolger als systematischer Theologe in Berlin, eine Lanze für den Zionismus. Gronauer zufolge betonte Marquardt, „dass der Zionismus nicht nationalistisch, geschweige denn rassistisch, sondern durch und durch jüdisch sei…“. Weiter: „Eine Spiritualisierung der biblischen Landverheißung wies er deshalb zurück: ‚Jesus Christus ist nicht Nein, sondern Ja und Amen auf alle Verheißungen. Auch auf diese.‘“ (225).
In die Schlussphase des betrachteten Zeitraums fiel der Überfall palästinensischer Terroristen auf die israelische Olympia-Mannschaft in München im September 1972. Über die Reaktion von Eugene Carson Blake (1906–1985), Generalsekretär des Weltkirchenrates, berichtet Gronauer: „Er sah bereits einen Tag nach dem Münchner Verbrechen dieses als eine Tat einzelner Extremisten an, die für den palästinensischen Befreiungskampf nicht repräsentativ seien. Zudem verurteilte er die deutschen Sicherheitskräfte zumindest indirekt dafür, den Forderungen der Geiselnehmer nicht nachgekommen zu sein.“ Diese Äußerung sorgte bei der Spitze der EKD für Empörung (367).
Auf dem Rücken von Gerhard Gronauers umfangreichem Werk findet sich eine Zusammenfassung des Forschungsertrags: „Die Staat-Israel-Rezeption war Veränderungen unterworfen, wenn auch nicht eindimensional, als ob der Protestantismus anfangs israelkritisch, dann israelfreundlich geworden sei – oder umgekehrt. Vielmehr war das Verhältnis zum Staat Israel vielschichtig und ambivalent. Der Rückblick auf diesen Diskurs lässt den Wert einer Diskussionskultur deutlich werden. Das Maßvolle und Bescheidene kann sich gegenüber radikalen Positionen als stärker erweisen.“
Dieser Einschätzung schließt sich der Rezensent an und wendet sie auf eine aktuelle Kontroverse im deutschen Protestantismus an, die Kontroverse um das Reizwort „Judenmission“. Gerhard Gronauer zeigt sich im Vorwort seines Werkes dankbar für die Vermittlung von hilfreichen Erkenntnissen aus der Theologischen Arbeitsgemeinschaft des Vereins „Begegnung von Christen und Juden in Bayern“. Dieser gehört zu einem Dachverband, der einmal den Namen „Evangelisch-Lutherischer Centralverein für Mission unter Israel“ trug, gegründet 1871. Dieser Verein hat sich vor wenigen Jahrzehnten neu ausgerichtet, vereinfacht ausgedrückt: weg von der Mission, hin zum Dialog. Diese Neuausrichtung hat sich augenscheinlich auch auf die Forschungsarbeit von Gerhard Gronauer ausgewirkt. Er verwendet sehr sparsam die Bezeichnung „messianische Juden“ für Menschen aus dem jüdischen Volk, die sich zu Jesus von Nazareth als dem jüdischen Messias bekennen. Gronauer bevorzugt die Bezeichnung „Christen jüdischer Herkunft“. Messianische Juden, deren Zahl innerhalb und außerhalb Israels seit Jahrzehnten im Wachsen begriffen ist, verstehen sich jedoch nicht als Menschen, die zwar vom Jude-Sein herkommen, sich davon aber abgewandt haben. Sie wollen ihren Weg des Glaubens an den Gott Israels als jüdischen Weg gehen. Der Rezensent plädiert für den Abschied von einer „radikalen Position“: „Der Glaube an den jüdischen Messias Jesus entfremdet Juden ihrer Nation.“ Wohin? Zur Bereitschaft im gesamtdeutschen Protestantismus, messianische Juden als Geschwister im Glauben wahrzunehmen und auch mit ihnen den Dialog zu pflegen.
Pfarrer Martin Rösch, Theologischer Leiter AmZI, CH-4153 Reinach, BL

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung – Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.