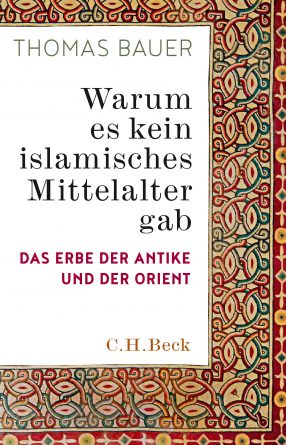Thomas Bauer: Warum es kein islamisches Mittelalter gab
Thomas Bauer: Warum es kein islamisches Mittelalter gab. Das Erbe der Antike und der Orient, München: Beck, 2018, geb., 175 S., € 22,95, ISBN 978-3-406-72730-6
Der Titel hält die zentrale These des Buches fest. Diese These erscheint so einfach und nachvollziehbar, wenn sie von Thomas Bauer nach und nach erläutert und begründet wird. Man wundert sich geradezu, warum sie nicht schon viel früher vertreten wurde. So selbstverständlich ist es, dass Begriffe wie Mohammedaner oder Neger nicht mehr gebraucht werden, so naheliegend ist es, „islamisches Mittelalter“ aus dem Wortschatz zu streichen. Damit leitet Bauer sein Vorwort ein. Ob diese beiden Fragen wirklich auf der gleichen Ebene liegen, mag man diskutieren. Das Interesse für die folgenden Seiten ist auf jeden Fall geweckt.
Die Unangemessenheit einer Rede von einem islamischen Mittelalter legt der Verfasser in seinem ersten Kapitel „Das ‚islamische Mittelalter“: Sechs Gründe dagegen“ (11–31) eindrücklich dar. Der Begriff ist unpräzise, da weder „islamisch“ noch „Mittelalter“ Klarheit bringen hinsichtlich der Frage, was damit gemeint ist. Außerdem verleitet er zu Fehlschlüssen, so als ob diese Zeit besonders religiös war bzw. alle Lebensbereiche vom Islam dominiert waren. Diese Kritik ist nicht zuletzt von dem getragen, was Bauer in seinem Buch Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Berlin: Insel, 2011 entfaltet hat (vielleicht sollte man die beiden Bücher gemeinsam lesen). Drittens kann dieser Begriff im Hinblick auf diese Zeit negativen Konnotationen hervorrufen, wenn „mit dem Mittelalter […] ja auch keine reale Epoche gemeint [ist], sondern ein überzeitliches Phänomen der Rückständigkeit und des religiösen Fanatismus“ (20). Viertens vollzieht sich mit dem Gebrauch des Begriffs eine Exotisierung, die gleichzeitig distanzierend und usurpierend wirkt. Fünftens leistet er einer eurozentrischen Perspektive Vorschub, präsentiert eine europäische Entwicklung als erstrebenswert oder gar als Norm. Zuletzt ist der Begriff „Mittelalter“ schon für den europäischen Kontext durchaus umstritten und nicht unbedingt hilfreich, „Ein Begriff ohne sachliche Grundlage“ (28). Am Ende des Buches schlussfolgert er noch, dass die Bezeichnung den Blick auf „die wirklichen Epochengrenzen“ verstellt (149).
Nachdem Bauer den Begriff dekonstruiert hat, beleuchtet er im zweiten Kapitel unter der Überschrift „Orient und Okzident im Vergleich: Von ‚Analphabetismus‘ bis ‚Ziffern‘“ (33–77) anhand von 26 Beispielen die Unterschiede zwischen Orient und Okzident. Manche Einträge sind sehr eindrücklich (wie Analphabetismus, Bäder oder Glas). Andere wirken missverständlich (wie Erbsündenlehre). Bauer malt ein Bild von heilsgewissen Muslimen, die nicht ernsthaft mit Höllenstrafen rechneten. Das hat mich nicht überzeugt, gerade auch weil Bauer selbst eingesteht, dass Furcht vor dem Jüngsten Gericht durchaus verbreitet war (41). Auch wäre noch einmal zu überlegen, ob sich die Juden in der islamischen Welt wirklich „auf ein hohes Maß an Autonomie“ (50) berufen konnten. Die Willkür ihnen gegenüber mag in Europa zwar größer gewesen sein, aber so rosig scheint mir das Bild nicht zu sein, wie Bauer es zeichnet. Insbesondere halte ich es für unangemessen davon zu reden, dass der Islam sich lediglich „neben das Christentum und die noch übrigen anderen Religionen stellte und damit die antike Religionspluralität wenigstens in gewissem Maße wiederherstellte“ (76). Erhellend dagegen erscheint die Beobachtung: „Bewahrung und Fortentwicklung der antiken Kultur kennzeichnen somit den Osten, weshalb es dort auch keine Renaissance geben konnte: Wo nichts gestorben ist, kann auch nichts wiederbelebt werden“ (75) zusammen. Dieser Spur sollte man folgen, weil sie fruchtbare Fragen provoziert und bemerkenswerte Perspektiven eröffnet.
Das dritte Kapitel „Auf der Suche nach dem ganzen Bild: Vom Mittelmeer bis zum Hindukusch“ (79–117) beleuchtet die Frage einer Epochenkonstruktion von verschiedenen Seiten. Bauer stellt eine Liste von Kriterien zusammen, die in ihrer Summe überzeugend sind, auch wenn man über manche Aspekte diskutieren kann. Eine Epochenbezeichnung sollte wertungsfrei, großräumig, umfassend lebensprägend und endgültig / dauerhaft sein. Durch diese Vorgabe schränkt er die Bedeutung von Politik, militärischen Erfolgen, Ereignisgeschichte und Religion für die Identifizierung und Beschreibung einer Epoche ein. Es geht ihm darum, dass Auswirkungen von Veränderungen „allgemein geworden sind“ (vgl. 154). Der Blick richtet sich damit auf längerfristige Prozesse, Prozesse „der Transformation und Reife, die irgendwann zu etwas Neuen führen, das als Ausgangspunkt einer neuen Epoche gelten kann“ (115). Mit dem Gedanken eines Merkmalsbündel nimmt Bauer Anleihen bei der Linguistik und schafft einen fruchtbaren Rahmen für die Diskussion. Auf diesem Hintergrund kommt er dann zum Schluss, dass sowohl in Europa wie in Westasien „eine Transformation der romano-graeco-iranischen Antike“ (107) stattfindet. Seine Perspektive ist dabei stark von einem Interesse an einer Literaturgeschichte geprägt (vgl. 107–114). Die Rede von einer formativen Periode lenkt den Blick von einer wesenhaften Begrifflichkeit hin zu einer prozesshaften (112).
Angeregt und ausgehend von Garth Fowdens Epoche eines ersten Jahrtausends (sowie seinen prophetischen, skripturalen und exegetischen Phasen; in Before and After Muhammad, The First Millennium Refocused, Princeton: UP, 2013) entfaltet Bauer im vierten Kapitel „Die islamische Spätantike: Die formative Periode der islamischen Wissenschaften“ (119–148) seine Überzeugung, dass man eine Epochengrenze um das Jahr 1050 annehmen sollte. Die Übersicht auf S. 122f fasst anschaulich zusammen wie in verschiedenen Wissensgebieten eine Synthese früherer Diskurse stattfindet und als Grundlage für folgende dient. So spricht Bauer von einer formativen Phase (bis ins 11. / 12. Jh), einer nachformativen Phase „mit einer kontinuierlichen Entwicklung der einzelnen Wissenschaften“ (12.–19. Jh) und einer Phase, die durch die Auseinandersetzung mit der globalisierten Moderne gekennzeichnet ist (140).
An manchen Stellen überdehnt der Verfasser seine These vielleicht. Manche pauschale Aussage mag eine rhetorische Zuspitzung sein, wie etwa: „In der Tat hat die Rede vom ‚islamischen Mittelalter‘ keinen anderen Sinn, als die europäische Deutungshoheit über die Weltgeschichte zum Ausdruck zu bringen“ (77), oder: „Dass der Begriff des Mittelalters hier nur für größtmögliche Vernebelung sorgt, ist offensichtlich“ (141). An manchen Stellen häufen sich die Pauschalisierungen und stehen in der Gefahr, größere Teile der Argumentation zu diskreditieren. Manch notwendige Differenzierung kommt etwas kurz oder erhält keinen Raum im Buch. Alles in allem liegt aber zweifelsfrei mit diesem Buch ein wertvoller Beitrag zu einer überfälligen Diskussion vor. Bauer provoziert an einigen Stellen. Der Beitrag ist auf jeden Fall anregend, engagiert und gut nachvollziehbar geschrieben und fordert zum Weiterdenken heraus, ja, es ist eine Einladung zum Um- und Querdenken.
Heiko Wenzel, Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule Gießen