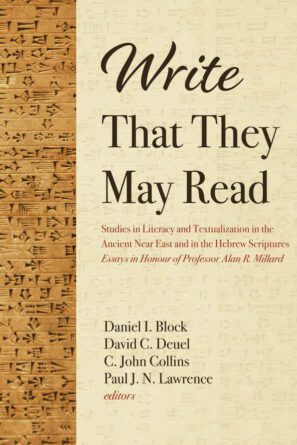Daniel I. Block / David C. Deuel / C. John Collins / Paul J. N. Lawrence (Hg.): Write That They May Read
Daniel I. Block / David C. Deuel / C. John Collins / Paul J. N. Lawrence (Hg.): Write That They May Read. Studies in Literacy and Textualization in the Ancient Near East and in the Hebrew Scriptures. Essays in Honour of Professor Alan R. Millard, Eugene OR: Pickwick Publications, 2020, Pb., XXXIV+504 S., $ 61,–, ISBN 978-1-7252-5210-3
Der vorliegende Sammelband zur Schreibkultur im AVO und den hebräischen Schriften ist Alan Millard gewidmet. Die 22 Beiträge stammen von zwei Generationen seiner Doktoranden und Schüler.
Der erste Teil widmet sich der Diskussion von Artefakten hinsichtlich minimaler Literalität. Gerald und Martin Klingbeil nehmen zwei Zwillingsbecher aus kultischen Räumen in Khirbet Qeiafa (10. Jh.) als Ausgangspunkt für methodische Überlegungen zur Deutung unbeschriebener Objekte bezüglich des Verständnisses kultischer Praktiken. – Timothy Crow fragt ausgehend vom El-Amarna Brief EA 256 und den darin erwähnten „Städten von mat-gari“ nach dem Verhältnis von schriftlichen und nichtschriftlichen (aber dennoch „lesbaren“) Quellen zur Deutung der machtpolitischen Konstellation in der spätbronzezeitlichen Golan-Jarmuk-Region. – Terence Mitchell†publizierteine beidseitig beschriebene Pfeilspitze aus dem British Museum. Der Pfeil ist beschriftet als „Pfeil von Ischbaal | Mann von Abday, dem Tyrer“, stammt wohl aus dem Libanon und datiert aufgrund der Buchstabenform ins mittlere 11. Jh. Dem Beitrag ist posthum ein Addendum von Richard Hess mit Vergleich der Namen mit westsemitischen Namen aus der frühen Eisenzeit angefügt. – Paul Lawrence stellt „Nestors Kelch“ aus Ischia bei Neapel vor (ca. 735–720). Die Nestor-Inschrift setzt entweder Kenntnis von Homers Ilias voraus oder zumindest Kenntnis eines Objekts, das bei Homer erwähnt wird. Möglicherweise handelt es sich um die älteste literarische Anspielung auf Homer. Lawrence zufolge liegt mit den Silberröllchen von Ketef Hinnom (7./6. Jh.) für die Hebräische Bibel ein ähnlicher Fall vor. Die literarischen Anspielungen umfassen Dtn 7,9 und den Priestersegen aus Num 6,24–26. Sie sprechen dafür, dass diese Texte zur Zeit der Herstellung der Silberröllchen eine gewisse Bekanntheit hatten. – Yoshiyuki Muchiki argumentiert, dass die hebräische Maßeinheit lōg (Lev 14) und der Name eines Schreibers Davids, Schawscha (1Chr 18,16), ägyptische Lehnwörter sind. Der Name komme von der ägyptischen Göttin des Schreibens (śšЗ.t). Zusammen mit dem Reisebericht des Wenamun (ca. 1075 v. Chr.) deute dies darauf hin, dass um ca. 1000 v. Chr. ägyptische Schreiber in der Levante aktiv waren.
Der zweite Teil befasst sich mit institutioneller Literalität. Gordon Johnston widmet sich dem Verhältnis der hethitischen Vasallenverträge zu Sinaibund und Dtn, mit Fokus auf dem ägyptisch-hethitischen Friedensvertrag zwischen Ramses II. und Hatussili III (Silbertafelvertrag). Während in der Forschung ein Einfluss der hethitischen Verträge auf das Deuteronomium teilweise via Aleppo und Karkemisch in der EZ vermutet wird, schlägt Johnston einen Einfluss via Ägypten in der SBZ vor. Ort (Pi-Ramesse, vgl. Ex 1,11) und Zeit (ca. 1259) des Silbertafelvertrages passen zur Datierung des Exodus im 13. Jh. – Daniel Block fragt, für wessen Augen eigentlich die Steintafeln in der Bundeslade bestimmt sind. Er vergleicht die göttliche Verschriftlichung des Dekalogs mit den adê-Tafeln, die im Allerheiligsten eines Heiligtums in Tel Tayinat gefunden wurden und mit dem Siegel des Gottes Assur versehen sind. Das Allerheiligste in Tel Tayinat war aber breiter zugänglich als das der Stiftshütte. Während zudem altvorderorientalische Verträge im Doppel für beide Vertragspartien abgefasst wurden, finden sich in der Pentateucherzählung beide Tafeln in der Bundeslade. JHWH sei darum Garant für beide Seiten des Bundesschlusses, die Tafeln sind für seine Augen bestimmt. – Jonathan Burnside geht der Anwendung geschriebenen Gesetzes im biblischen Israel nach. Er unterscheidet ein „semantisches“ von einem „narrativen“ Verständnis. Während Ersteres von unserem heutigen Gesetzesbegriff ausgeht und nach präziser Terminologie und umsetzbarer Vollständigkeit fragt, rechnet Letzteres mit gesellschaftlichem Vorwissen und versteht die verschriftlichten Fälle paradigmatisch. Burnside argumentiert an verschiedenen Beispielen (Ex 21,13–14; Lev 11,3–23; Num 15,32–26; Dtn 21,18–21; 14,3–20) für ein narratives Verständnis. – Wolfgang Ertl nimmt die Notiz über die Schreibtätigkeit Samuels in 1Sam 10,25 zum Ausgangspunkt für die Frage, ob Samuel im 11. Jh. schreiben konnte. Anhand eines Überblicks über die Evidenz für Literalität in verschiedenen Epochen bejaht er dies und versucht, zu rekonstruieren, was die Inhalte dieses von Samuel verfassten „Rechtsanpruchs des Königtums“ gewesen sein könnten. Er schlägt vor, dass Samuel eine Erstversion von 1Sam 1–15 verfasst habe als Verteidigungsschrift für sein scheinbar widersprüchliches Handeln in der Ein- und Absetzung Sauls. Zu 1Sam 10,25 wäre es interessant, zu bedenken, was die Niederlegung des Textes „vor dem Angesicht Jahwes“ für den Aufbewahrungsort zu bedeuten hat. – In einem kurzen Beitrag bespricht David Tsumura das Verhältnis von „rennen“ und „lesen“ in Hab 2,2c. Aufgrund des Subjektwechsels von der 2. zur 3. Person Singular geht er davon aus, dass die Schreibanweisung im ersten Versteil an den Propheten gerichtet ist, damit dann ein Bote, der nicht mit dem Propheten zu identifizieren ist, die Tafeln bekommt, um damit zu rennen und die Botschaft bekannt zu machen.
Im dritten Teil geht es um das Entstehen der literarischen Literalität. Richard Averbeck steuert einen grundlegenden Beitrag zur Geschichte und Vorgeschichte der hebräischen Sprache in der westsemitischen literarischen Tradition bei. Nach einem Überblick über die Forschungslage zur diachronen Linguistik des Hebräischen widmet er sich dem nordwestsemitischen linguistischen Kontext des Proto-Hebräischen. Dabei diskutiert er besonders die Ugarit-Texte in Alphabetschrift und die akkadisch-kanaanäische Mischform gewisser Amarna-Texte aus der südlichen Levante. Da es sich dabei um Zufallsfunde handelt, die ihr Überleben dem besonderen Schreibmaterial verdanken, hält er es für durchaus plausibel, dass die Spätbronzezeit ein passender Kontext für erste literarische Texte sein könnte, aus denen die Hebräische Bibel hervorgegangen ist. Die nordwestsemitische Tradition biblischer Texte zeigt er an zwei Beispielen, in denen er Genesis-Texte mit dem ugaritischen Baal-Zyklus vergleicht. – John Collins geht der Frage nach, ob der Rückgriff auf altorientalische Überlieferungen (besonders im Bundesbuch und in der Urgeschichte) sich mit der göttlichen Inspiration der Tora vereinbaren lässt, was er bejaht. – Jens Kofoed vergleicht den narrativen Rahmen der Pentateuchgesetze mit den Prologen sumerischer und akkadischer Gesetze. Während in Letzteren der Gesetzgeber beschreibt, was er für die Götter getan hat, sagt Gott in der Pentateuchrahmung, was er für das Volk getan hat. K. diskutiert den Einfluss dieses Unterschiedes auf die Herausbildung einer jüdisch-christlichen Kultur und thematisiert eine Re-Paganisierung des Westens in neuerer Zeit. – John Walton widmet sich der literarischen Produktion in einer primär mündlichen Kultur. Er betont, dass die Verschriftlichung in der Regel nicht am Anfang, sondern am Ende des Tradierungsprozesses steht und dass darum „Bücher“ und „Autoren“ anachronistische Konzepte sind, was die einleitungswissenschaftliche Diskussion von „Verfasserschaft“ und „Datierung“ infrage stelle. – James Hoffmeier vergleicht die Wiederentdeckung des Schabaka-Steins („Memphitische Theologie“) mit der Wiederentdeckung des Gesetzesbuches in der josianischen Reform nach 2Kö 22,8–10. Ersterer wurde im späten 8. Jh. v. Chr. im Ptah-Tempel in Memphis wiederentdeckt. Hoffmeier beschreibt die Zeit des 8./7. Jh. v. Chr. in Ägypten und Mesopotamien als eine Zeit der Wiederentdeckung alter Klassiker, nicht jedoch als eine Zeit literarischer Innovation. Auch das Gesetzesbuch sei eher eine Wiederentdeckung eines alten Werkes als ein neues Werk, das untergeschoben wurde. – David Deuel arbeitet im Dtn ein Unterweisungsmuster heraus, das von passivem Empfangen zu aktivem Weitergeben verläuft (versammeln – lesen – hören – lernen – fürchten – anbeten – gehorchen – lehren). Dieses Muster sei prägend ist für biblische Unterweisung im AT und NT. – Ernest Lucas vergleicht die Uruk-Prophetie mit messianischen Texten des AT. Während sie in der Hoffnung eines idealen Königtums übereinstimmen, gebe es keine Evidenz, dass aus der Uruk-Prophetie eine messianische Hoffnung im Volk entstanden sei. Vielmehr sei sie primär eine Propagandaschrift zur Legitimierung eines neuen Königs mitsamt der aus ihm hervorgehenden Dynastie. Überlegungen zum Messiasanspruch Jesu runden den Beitrag ab. – Nach Cheryl Eaton ist Jos 24 ein wichtiger Referenztext für Ps 81. Die Intertextualität scheint mir aber eher schwach begründet, finden sich alle genannten lexikalischen Übereinstimmungen doch auch im Umfeld des Moseliedes Dtn 32, wobei in den Rahmenversen Ps 81,2 (vgl. Dtn 32,43) und v. a. Ps 81,17 (vgl. Dtn 32,13–14) sehr viel spezifischere Bezüge das Moselied als Leittext für Ps 81 ausweisen.
Ein vierter Teil enthält zwei Beiträge zu metaphorischer Literalität. Carmen Imes gibt einen Überblick über die Evidenz von Siegeln mit alphabetischer Inschrift im altorientalischen und biblischen Kontext. Davon ausgehend geht sie dem metaphorischen Gebrauch von Siegeln in der Bibel und bei den Kirchenvätern nach und folgert, dass Gott ein Siegel mit seinem Namen besitzt, um sein Volk mit seinem Namen als seinen Besitz zu kennzeichnen. – Rahel Wells untersucht den metaphorischen Gebrauch von „Auge“ im Dtn und arbeitet eine eher kognitive („Brain and Judgement“) und eine emotionale („Heart and Emotions“) Verwendung heraus. Als Hauptgrund für die Differenz dieser metaphorischen Verwendung zu den übrigen Pentateuchgesetzen vermutet sie den stärker parenetischen Charakter des Dtn.
Der Band schließt mit zwei epilogischen Beiträgen. Richard Hess macht in einer Antwort an Stephen Young einige Klarstellungen zu seiner eigenen Position über die Verbreitung von Literalität in Israel zu alttestamentlicher Zeit. – Der von Edwin Yamauchi verantwortete Schlussbeitrag würdigt das umfangreiche und vielfältige Werk von Alan Millard thematisch geordnet. Dieser voluminöse Sammelband trägt nicht nur ganz unterschiedliche Beiträge zur Text- und Schreibkultur im Alten Vorderen Orient und den hebräischen Schriften zusammen, sondern zeigt auch etwas von der Breite des Werks von Alan Millard und von dessen Wirkungsgeschichte über zwei Generationen seiner Schüler.
Prof. Dr. Benjamin Kilchör, Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel