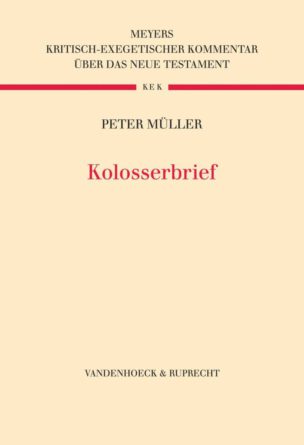Peter Müller: Kolosserbrief
Peter Müller: Kolosserbrief, KEK 9/2, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2022, 440 S., € 110,–, ISBN 978-3-525-57333-4
In der 16. Auflage des Kolosserkommentars der renommierten Reihe Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament wird Eduard Lohses Beitrag (15. Aufl., 1977) durch eine umfangreiche Auslegung von Peter Müller ersetzt. Wie Lohse will auch M. den Kol vor dem Hintergrund des philosophischen und religiösen Umfelds Kleinasiens im späteren 1. Jh. verstehen. Ein Blick auf die Bibliografie lässt einen darüber staunen, wie viele relevante Forschungsbeiträge in den letzten fünfzig Jahren hinzugekommen sind. M. arbeitet sie mit geschultem Auge und großer Kompetenz in seine Auslegung ein.
Die Kolosser-Forschung der Gegenwart beschäftigt sich mit ein paar zentralen Themen. M.s Meinung dazu soll im Folgenden kurz geschildert werden. 1. Er hält den Kol für einen pseudepigraphischen Brief eines „offensichtlich in paulinischer Tradition“ stehenden „Christ[s] der zweiten christlichen Generation“ (400), der gegen 80 n. Chr. entstanden ist. Der Autor entstammt dem Lykostal, und der Brief ist an dortige Gemeinden adressiert. 2. Die sogenannte „kolossische Irrlehre“ ist nicht, wie öfters in letzter Zeit erwogen wird, eine Fiktion, die dem Autor als Kontrastfolie zu seiner Lehre dient, sondern sie stellt die Position einer realen Gruppe dar, die Einfluss unter den Gläubigen in Kolossä gewonnen hat. Diese Gruppe ist im Detail nicht auszumachen, aber sie legte offensichtlich Wert auf Engelverehrung, Speisevorschriften und Weisheit. Es handelt sich dabei um eine in der hellenistischen Umwelt weit verbreitete „Kombination von Traditionen, kultischen Vorstellungen und Verhaltensanweisungen“ (272). Diese sind hauptsächlich paganen Ursprungs, aber jüdische Einflüsse sind nicht auszuschließen. 3. Das Christuslied (1,15–20) deutet M. als zweiteiliges frühchristliches Traditionsstück, das der Autor nur an einer Stelle ergänzt habe – mit τῆς ἐκκλησίας in 1,18a. Das Lied bedient sich hellenistischer bzw. hellenistisch-jüdischer Traditionen und will die sich noch im Prozess der Identitätsfindung begriffenen Gemeinden von „dem unbedingtem Vorrang Christi als Schöpfungsmittler und Versöhner“ überzeugen (186). 4. Die Haustafel (3,18–4,1) ist eine dem frühchristlichen Traditionsgut angelehnte Eigenkomposition des Autors. Sie kann weder einem spezifischen religionsgeschichtlichen Hintergrund noch einer einzelnen antiken Gattung zugeordnet werden. Obwohl sie moderne Leser befremdet, ist ihr als Versuch, den christlichen Glauben im damaligen Kontext alltagstauglich zu machen, Beachtung zu schenken.
Besonders hilfreich ist M.s Behandlung der verschiedenen „Sinnlinien“ bzw. „mehrfach wiederkehrende[n] Elemente“ in der Einführung (58). Diese lassen den Kol erst ein in sich zusammenhängendes Schreiben werden. Acht Exkurse bereichern die Auslegung. Zwei davon verdienen besondere Beachtung: 1. „Die anti-imperiale Lektüre des Briefes“ (240–241). M. betrachtet diese – m. E. zurecht – mit Skepsis. 2. „Paulusschule“ (407–412). M. zögert aus nachvollziehbaren Gründen davon zu sprechen.
In der Frage der Verfasserschaft fällt auf, mit welchem Nachdruck M. seine Position darlegt. Die stilistischen und theologischen Unterschiede zu den unumstrittenen Paulinen „lassen keinen anderen Schluss als den zu, dass der Kolosserbrief nicht von Paulus geschrieben sein kann“ (392). M.s Zuversicht ist eher für das letzte Viertel des 20. Jhs. charakteristisch. Neuere Kommentare präsentieren ihre Ergebnisse vorsichtiger. Diese neue Vorsicht ist angemessen.
Das betrifft zunächst die Diskussion der „Sprach- und Stileigentümlichkeiten“ des Kol. Diese führten Walter Bujard in seiner 1973 Dissertation (Stilanalytische Untersuchungen zum Kolosserbrief) zum Schluss, dass der Brief nicht vom Apostel stammt. Bis heute beruft sich die deutsche Forschung auf ihn. Laut M. könne z. B. hinter Bujards Untersuchung „nicht zurückgegangen werden“ (72). Aber M. rezipiert die wissenschaftliche Diskussion der Stylometrie nur bis in die 1990er Jahre. Neuere Studien, unterstützt durch ausgereiftere Computeranalysen, stellen Bujards Schlüsse neu zur Diskussion. B. White bezweifelt, dass das Corpus Paulinum einen Mindestumfang hat, der es stilistischen Untersuchungen ermöglichen würde, belastbare Ergebnisse zu erzielen. J. van Nes konnte zeigen, dass einige der Protopaulinen im selben Ausmaß von einer stilistischen Norm abweichen wie die vermeintlichen Deuteropaulinen. S. McKnight erhebt aufgrund von Untersuchungen zum Briefschreiben in der Antike den Einwand, dass wir keine rein paulinischen Paulusbriefe haben, die als Kontrollinstanz in Fragen der Sprache und des Stils dienen können. Es ist nämlich davon auszugehen, dass alle unter dem Mitwirken einer sich abwechselnden Gruppe von Mitarbeitern verfasst wurden.
Größere methodische Vorsicht ist auch im Umgang mit den theologischen Besonderheiten des Kol geboten. M. vergleicht dreizehn „theologischen Hauptlinien“ des Kol mit Aussagen in den unumstrittenen Paulinen (366–392) und stellt fest, dass der Kol in allen Themenbereichen „charakteristische Unterschiede“ aufweist. Dabei behandelt er die unumstrittenen Paulinen als wären diese ein einheitliches Werk. Er macht auch keine Gegenprobe; das ist aus methodischer Sicht ein Manko, das die Aussagekraft seiner Analyse ernsthaft in Frage stellt. Wir wissen nämlich nicht, ob nicht der Gal oder der 1Kor im Vergleich zu den anderen unumstrittenen Paulinen vergleichbare „charakteristischen Unterschiede“ aufweist, und können deswegen auch keine Schlüsse über den Kol ziehen. Meine eigenen vorläufigen Gegenproben lassen Zweifel aufkommen, dass die theologischen Besonderheiten des Kol so auffällig sind, wie M. behauptet. Der Phil z. B. erwähnt den Geist genauso selten wie der Kol und beschäftigt sich genauso wenig mit der Macht der Sünde, und der 2Kor scheint genauso wenig am Geschick Israels interessiert zu sein wie der Kol. Alle Paulusbriefe weisen im Vergleich zum Corpus Paulinum als Ganzes theologische Eigentümlichkeiten auf. Das macht sie so interessant und vielfältig anwendbar. Wer die unumstrittenen Paulinen zum monotonen Maßstab der Authentizität macht, traut Paulus, einem der geistreichsten Theologen in der Geschichte des Christentums, zu wenig zu. Er spricht dem Apostel die Fähigkeit ab, seine Christologie kosmisch, seine Ekklesiologie universal und seine Eschatologie (auch) realisiert zu denken. Er ist gezwungen, solche kreativen Lösungen für die theologischen Herausforderungen der Gemeinden im Lykostal einem namenslosen Nachahmer der zweiten Generation zuzuschreiben. Ich tippe eher auf Paulus.
Dr. Joel White, Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule Gießen