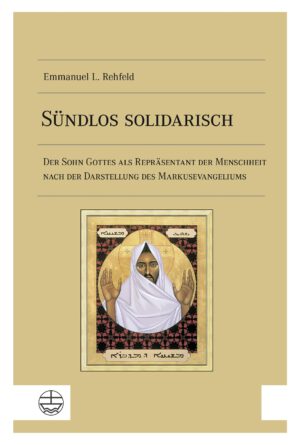Emmanuel L. Rehfeld: Sündlos solidarisch
Emmanuel L. Rehfeld: Sündlos solidarisch. Der Sohn Gottes als Repräsentant der Menschheit nach der Darstellung des Markusevangeliums, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2024, geb., 559 S., € 103,55, ISBN 978-3374075614
„Dieses Buch ist ein Wagnis, möglicherweise ein Ärgernis“ – so beginnt das Vorwort dieser Habilitationsschrift, die im Sommersemester 2020 von der Fakultät „Humanwissenschaften und Theologie“ der TU Darmstadt angenommen wurde und die nun in gedruckter Form vorliegt. Für die Druckfassung wurde nachträglich erschienene Literatur „nur noch vereinzelt berücksichtigt“. Dass die Arbeit nicht, wie für neutestamentliche Habilitationen üblich, in einer entsprechenden Monografie-Reihe erschienen ist, mag damit zusammenhängen, dass sie in der Tat von manchen als „Ärgernis“ empfunden wurde. Vielleicht ist sie aber einfach zu wichtig, um in einer Monografie-Reihe einfach als eine beliebige weitere Nummer eingeordnet zu werden. Es ist ein herausforderndes Buch in mehrfacher Hinsicht: Es mutet besonders den neutestamentlichen Kollegen im Bereich der Jesus- und Evangelienforschung Überlegungen zu, die von der Mehrheit wohl als eher randständig oder als ›zu dogmatisch‹ angesehen würden. Dazu kommt, dass es in einem Duktus geschrieben ist, der den Indikativ bevorzugt. Das Selbstbewusstsein des Autors, dass Markus nur so verstanden werden kann (z. B. 217) und alle anderen Lesarten, insbesondere solche, die einen stärker historisch basierten Zugang suchen, s. E. weder kohärent noch konsistent sind, ist mutig, streift im Ton aber manchmal an Überheblichkeit (z. B. 43) und erschwert es unnötig, dem Vf. da zu folgen, wo er einen auf unbekanntes bzw. bisher unbedachtes Terrain führen will, das es – da ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen – unbedingt zu entdecken gilt. Der Stil ist eloquent, anspruchsvoll, aber eben auch nicht selten provozierend selbstgewiss. Konjunktive sind selten, der Indikativ bestimmt die Syntax, denn hier werden nicht Thesen zur Diskussion gestellt, sondern die Wahrheit des Evangeliums, das nur so und nicht anders verstanden werden kann, vordemonstriert.
Es ist ein gelehrtes, akribisch recherchiertes Buch, das bis ins Detail methodisch reflektiert seine Ergebnisse vorträgt. Auch optisch ist das Buch sehr ansprechend; lediglich im letzten Teil ab „Epilog“ (465) häufen sich die ›großen‹ Überschriften, denen dann nur zwischen einer halben und 3 Seiten Text folgt. Hervorgehoben zu werden verdient, dass die Satzvorlage vom Autor selbst erstellt wurde. Mir sind keine Druckfehler aufgefallen!
Die Arbeit besteht aus insgesamt sieben Teilen (I–VII). Der erste Teil widmet sich Thema und Fragestellung (dazu gleich mehr), die folgenden fünf Teile sind dann ein mehrfacher Durchgang durch das MkEv mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Eigenart der markinischen Jesusdarstellung (Teil II), Christologische Grundlegung (u. a. über Präexistenz, Gottessohnschaft und Menschensohntitel, mit besonderer Berücksichtigung der Eingangs- und Schlussteile, Mk 1,1–15 und 16,1–8), Begriffsklärungen (Teil IV, hier geht es vor allem um Begriff und Darstellung von „Sünde“ im MkEv mit καρδία als Schlüsselbegriff: nur wer ein „reines Herz“ hat, ist ohne Sünde; Mk 7,1–23 ist hier der wichtigste Texte). Den Höhepunkt bzw. die Zusammenschau dieser hinführenden Teile sind dann Teil V (Die faktuale Sündlosigkeit Jesu in der Darstellung des Markusevangeliums bis zur Passion) u. Teil VI, wo die Sündlosigkeit Jesu im Passionsbericht demonstriert wird. Am Ende dann Teil VII „Ergebnis und Ausblick“ in sieben Punkten. Eine 7×7-Struktur also, die bei einer so präzise vermessenden Arbeit wohl kein Zufall ist. Hier spiegelt sich die Perfektion, die der Vf. in Jesus (und im MkEv) findet, in der symbolischen Harmonie der Gliederung.
Das zentrale Anliegen der Arbeit lässt sich vielleicht so bestimmen: Wer hat im Hinblick auf das ontologische (und damit eben auch historische) Dasein des Jesus von Nazareth recht? Das Chalcedonense mit seinem „vollkommen in puncto Gottheit und derselbe vollkommen in puncto Menschsein … doch ohne Sünde“ (17) oder die durch Eilert Herms repräsentierte neuzeitliche Position, wonach die historisch-kritische Suche nach dem historischen Jesus dazu geführt hat, dass „die Christuslehre des altkirchlichen Dogmas nicht die in den Schriften der γραφή selbst enthaltene“ ist (19). Martin Hengels Anmutung, dass „die Dogmenbildung in der Alten Kirche“ in der ihr vorgegebenen griechischen Sprach- und Denktradition „im Grunde nur konsequent weiterführte und vollendete, was sich im Urgeschehen der ersten beiden Jahrzehnte bereits entfaltet hatte“ (19) wird in dieser Arbeit aufgenommen und, wenn man so will, glänzend bestätigt. Der Evangelist Markus bezeugt nach Rehfelds Analyse nicht nur „Jesu Sündlosigkeit … in soteriologischer Perspektive“ (473; diesem Nachweis dient der insgesamt umfangreichste Teil V, 253–382), sondern diese wird präzisiert als eine „impeccantia de facto“ (475), womit gemeint ist, dass auch die Inkarnation, die Rehfeld für das MkEv vor allem aufgrund von Mk 1,2f. als „Statuswechsel des einen, bereits präexistent agierenden Subjekts Jesus Christus“ voraussetzt (158, Hgh. im Original), sein Wesen in keiner Weise mit der Sünde assoziiert habe. Nicht nur wird keinerlei Gebotsübertretung von Jesus überliefert (wo es der Fall ist, haben seine Ankläger Unrecht), sondern auch kein Murren und Schwanken in seiner Gottesbeziehung und seinem unbedingten Gehorsam gegenüber Gott dem Vater, so dass das Wohlgefallen des Vaters an seinem Sohn ein dauerhaftes und ununterbrochenes war.
Die in diesem Zusammenhang gemachten exegetischen Beschreibungen sind valide, aber sie werden nun eben doch zur Beantwortung einer Frage herangezogen, die das MkEv selbst nicht stellt. Rehfeld diskutiert diesen Einwand ausführlich, gibt aber zu bedenken, dass die Verwendung des argumentum e silentio nicht von vornherein unangebracht ist, sondern methodisch reflektiert angewandt auch zu gültigen Schlussfolgerungen führen kann (41 u. ö.). Dennoch ist seine Argumentation m. E. manchmal überzogen. So wird dem Verhör Jesu ein ganzes Kapitel gewidmet (261–277) und die Tatsache, dass man nichts gegen Jesus vorbringen konnte, wird als Argument für seine Sündlosigkeit verwendet. Aber wie Mk 14,55 deutlich macht, ging es in diesem Verfahren darum, eine Zeugenaussage gegen Jesus zu finden, „um ihn zum Tode verurteilen zu können“ (μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν). Dass dies nicht gelang, besagt nichts über die Sündlosigkeit von Jesus.
Rehfeld ist mit diesem Befund über die völlige Sündlosigkeit jedoch noch nicht zufrieden, sondern er schreibt: „Nun verlangt aber nach C. Hennemann die – wie er sie nennt – »thatsächliche Sündelosigkeit« Jesu »als ihren Grund Jesu Unsündlichkeit […], d. h. die grundsätzliche oder persönliche Unmöglichkeit zu sündigen«“ (477). Nach Rehfeld gilt es darum zu fragen: „Stellt der älteste Evangelist die Sündlosigkeit Jesu lediglich als ein kontingentes historisches Faktum dar, oder ist er von ihrer prinzipiellen Notwendigkeit überzeugt?“ (477). Muss also von Jesus ein non potuit peccare (477 Anm. 12) bekannt werden? Es erstaunt nach der Lektüre nicht, dass der nächste Abschnitt dann die Überschrift trägt: „Jesu Sündlosigkeit als impeccabilitas de necessitate“ (479f.). Diese ist nach Rehfeld notwendig, weil sonst „die Tatsache der ungebrochenen Gottessohnschaft und Sündlosigkeit Jesu ja auch auf seine Bewährung und seinen Gehorsam“ zurückgeführt werden könnte, was aber auf keinen Fall sein darf, denn dagegen spreche „die gottgewollte Notwendigkeit und Zielgerichtetheit seiner Geschichte“ (480). Ich gestehe, dass ich das nicht verstehe. Die Vorstellung, dass Jesus hätte scheitern können, ist für Rehfeld völlig inakzeptabel – für mich ist sie der Höhepunkt dieses einzigartigen Lebens. In summa: hier wird ein nach einer bestimmten dogmatischen Tradition korrekter Gottessohn Jesus im Text gefunden, der für mich als „wahrer Mensch“ nicht mehr erkennbar ist und von dem ich mir nicht vorstellen kann (was Rehfeld als Argument vehement zurückweisen würde, weil die historische Vorstellung der Exegeten die Wurzel allen Übels in der Jesusforschung sind), dass der Evangelist Markus, ein Jerusalemer Jesusjünger, der mit Paulus und Petrus unterwegs war, all das wusste und bedachte, was sein Ausleger in ihm findet.
Aber wer Markus war oder was er dachte, ist ohnehin nur von historischem Interesse und darum theologisch irrelevant. Einleitungsfragen spielen in dieser Studie keine Rolle, sie kommen schlicht nicht vor, denn „Gegenstand der Exegese sind die von ihr zu analysierenden Texte in der ihr vorliegenden Gestalt“ (53). Wie es zu diesen Texten kommt, hat dabei keine tragende Funktion. Das älteste Evangelium ist Markus, sein Verfasser wird als Evangelist bezeichnet, aber Ort, Zeit, Herkunft, der Weg der Überlieferung zu Markus etc. – all das wird nicht tangiert. Gleichzeitig ist aber das Evangelium ein Muster an Klarheit, Stringenz und rhetorischer Brillanz, in dem alles wohlbedacht ist. Das ist eine Form von Bibliolatrie, die sich jede historische Nachfrage verbittet, weil das Endprodukt als solches unantastbar ist. Ohne dass das Wort „Inspiration“ in diesem Zusammenhang vorkommt, liegt dieser bewusst und vorsätzlich ahistorischen Perspektive auf den Text eine Dignifizierung zugrunde, die diesen im Sinne der klassischen Inspirationsvorstellung unantastbar macht (was käme wohl heraus, wenn mit derselben Energie ein apokryphes Evangelium analysiert würde?). Zwar sieht Rehfeld die Gefahr eines „textontologischen Reduktionismus“ (69) und insistiert, dass seine Arbeit auch einen Beitrag zum „Verhältnis von Glaube und ‚Geschichte‘“ darstellt (49), allein da fehlt mir der Glaube, weil die Geschichte bei ihm offenbar nur in Anführungszeichen begegnet. Aus diesem Grund wird auch der Schluss Mk 16,8 mit viel Aufwand als „Leseanweisung“ verstanden, „die zum rechten Umgang mit dem schriftgewordenen Evangelium anleiten will, nämlich zu einer Relektüre unter veränderten Vorzeichen“ (125). Die schlichte Tatsache, dass die Mehrheit der Abschreiber mit diesem Schluss offenbar nicht zufrieden war, sondern ihn zu ergänzen suchten, müsste dann doch zumindest das Zugeständnis erwecken, dass diese literarische Vollkommenheit erst den literaturwissenschaftlich geschulten Exegeten des 20. und 21. Jahrhunderts zu entdecken vergönnt war. Auch wird an keiner Stelle darüber nachgedacht, warum das MkEv, wenn es doch in so einzigartiger Weise (und nach Meinung des Vf.s auch in so klarer Weise, dass jeder, der Augen hat zu sehen, es sehen kann) die Menschwerdung des Gottessohnes bezeuge und seine damit verbundene Sündlosigkeit, dann so überhaupt keine Rolle in der Entwicklung des Dogmas und in der Lehre und Predigt der Kirche gespielt hat. Die wirkungsgeschichtlich bedeutenden Evangelien sind Matthäus und Johannes, und eben nicht Markus, der seine Prominenz seiner erst im 19. Jh. behaupteten chronologischen Vorrangstellung verdankt. Da aber das historische Argument für Rehfeld ansonsten keine erkennbare Bedeutung hat, ist hier doch eine gewisse Markus-Idealisierung erkennbar. Dass Rehfeld den Evangelien von Matthäus und Lukas mit ihren Kindheitsgeschichten offenbar nichts abgewinnen kann, sondern darin sogar eine Art historisierenden Rückfall andeutet, verwundert darum nicht, vgl. 213: „Stammbaum, Geburtsgeschichte und andere biographische Elemente sind entbehrlich, denn ‚seine menschliche Abstammung reicht nicht aus, zu erklären, wer er ist‘“ (das Zitat im Zitat stammt von Ludger Schenke, der neben Martin Dibelius auffällig oft vorkommt). Nur weil etwas nicht ausreicht, heißt es nicht, dass es entbehrlich ist, sondern nur, dass noch Weiteres dazukommen muss, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Eine Folge von Rehfelds Enthistorisierung zugunsten der reinen Lehre ist auch seine distanzierte Beschreibung der jüdischen Mitwelt Jesu bzw. von Jesu Judesein. So ist für Rehfeld außer Frage, dass „das Markusevangelium Jesus gar nicht als Messias“ darstellt, weil Jesus mit der „Kategorie »Messias« keineswegs adäquat erfasst wird“ (93). Dass Jesus die Messiaserwartungen seiner Zeit nicht einfach erfüllte, sondern eigenständig interpretierte, ist zweifellos richtig. Ihn aber nicht als Messias zu verstehen (man fragt sich, ob der Affront gegen den eigenen Lehrer Rainer Riesner, dessen Jesusbuch den Titel „Messias Jesus“ trägt und dessen FS Rehfeld mitherausgegeben hat, intendiert ist), bedeutet eine gewaltsame Interpretation des Χριστός-Titels in Mk 1,1 (wo Rehfeld alle Aufmerksamkeit auf das υἱὸς θεοῦ legt) und eine weitere Distanzierung von einem jüdischen Verstehenshorizont. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem „markinische[n] Christuszeugnis und [der] Abwegigkeit historischer Rückfragen“ (105–107), das nur zeigen will, dass „die prädestinatianische Intentionalität und teleologische Zuspitzung das vom Evangelium Erzählte als historisch derart unwahrscheinlich erscheinen“ lassen, „dass sich die historisch ausgerichtete Exegese immer wieder zu textfremden Umdeutungen verleiten lässt“ (105). Das wird dann an R. Bauckham, J. D. G. Dunn, D. L. Bock u. a. illustriert.
Zum Versuch, die positiven Christus-Belege abzuschwächen s. 167–171. Die Belege, die sich offenbar nicht in dieser Weise abschwächen lassen (Mk 9,41; 13,21) werden dann so verstanden, dass sie „uneingeschränkt bejaht“ erst im „frühchristlich-nachösterlichen Sinne“ seien. Hier zeigt sich das Problem, dass Rehfeld nahezu nie diskutiert, ob die Jesus zugeschriebenen Aussagen nun in der Tat Worte sind, die der irdische Jesus so gesagt hat. Denn 9,41; 12,35 u. 13,21 können auf der Textebene nur so verstanden werden, dass Jesus in seinen Aussagen oder Fragen voraussetzt, dass er der Messias ist (bzw. von seinen Gesprächspartnern als solcher gesehen wird). Dass sein Selbstverständnis als Messias anders ist als das seiner Gesprächspartner, ist zwar richtig, aber es ist dennoch ein verbindendes Element, indem die Messiaserwartungen durch das Reden und Tun des Messias Jesus verändert werden. Aber gerade der Hinweis auf den „Sohn Davids“ (Mk 12,35, vgl. auch Mk 10,47f.; 11,10), der positiv mit Jesus verbunden ist, zeigt – neben anderem, z. B. Mk 11,2 mit der bewussten Bezugnahme Jesu auf Sach 9,9 und verwandte Texte –, dass die jüdische Messiaserwartung von Jesus aufgenommen wird und er als „König der Juden“ (Mk 15,2.26 für den Kreuzestitulus) stirbt (vgl. dagegen Rehfeld 170, für den das alles Fehldeutungen sind). Aber solche Argumente sind für Rehfeld nicht valide, da „grundsätzlich“ die Synoptiker die Jesus-Geschichte aus einer „der Auferstehungswirklichkeit verpflichtete[n] Perspektive“ beschreiben und damit Vorösterliches und Nachösterliches unauflösbar narrativ miteinander verbinden (96). Das ist richtig und wird auch von denen, die stärker nach dem historischen Vorgang fragen, der zu dieser Verschränkung führte, gesehen. Ärgerlich ist jedoch, dass dieses Bemühen um ein sachgemäßes historisches Verständnis dessen, was zu den Aussagen der Texte geführt hat, mehr oder weniger karikierend beiseitegeschoben wird. Dass Rehfeld auf diesen Seiten (96f.) ausführlich nur sich selbst zitiert, ist zumindest ein wenig befremdlich (weitere Betonungen des Nichthistorischen 120.124.174f.209.212.239 u. ö.).
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit knapp 50 Seiten zeigt die Gründlichkeit der Untersuchung an, wobei Literatur aus einem sehr breiten Spektrum herangezogen wird: so fallen die vielen französischen Titel auf (vielleicht nicht ungewöhnlich für einen Schweizer Verfasser), aus denen in manchen Teilen sehr umfangreich zitiert wird, was es für des Französischen Unkundige sehr erschwert, diesen Argumentationen zu folgen. Auch Latein wird relativ großzügig und unübersetzt verwendet. Weiter – aber angesichts des Themas vielleicht nicht erstaunlich – sind zahlreiche katholische und orthodoxe Beiträge insbesondere zum Thema Sündlosigkeit verarbeitet, die z. T. recht alt sind. Überhaupt fällt die relative breite Berücksichtigung von Literatur aus dem 19. Jh. und älter auf. Das ist insgesamt sehr positiv, weil man mit vielen unbekannten Namen bzw. sehr lange nicht mehr gelesenen Namen auf diese Weise erstmalig oder wieder in Kontakt kommt. Es hätte aber zumindest mir geholfen, wenn die Unbekannteren mit einem Satz eingeführt und in der theologischen Landschaft verortet worden wären. So fragt man sich ständig (weil in den Fußnoten nur Vf. und Kurztitel genannt werden, aber nie das Datum), ob man da einen wichtigen Beitrag in der gegenwärtigen Diskussion übersehen hat, nur um dann – irgendwie beruhigt – im Literaturverzeichnis festzustellen, dass es u. U. verzeihlich ist, wenn man die 1898 erschienene Dissertation des katholischen Priesters Carl Hennemann (1841–1905) nicht kennt (erst auf 477 wird er als römisch-katholischer Apologet aus dem 19. Jahrhundert eingeführt). Einige weitere Auffälligkeiten im Literaturverzeichnis seien noch angemerkt: Stil und Methode der Arbeit wird verständlich, wenn man sieht, dass etwa Otfried Hofius in der Bibliografie eine ganze Seite füllt, Martin Hengel dagegen nur sechs Einträge hat und Rainer Riesner, immerhin der Doktorvater von Rehfeld, sogar nur zwei. Angesichts der Bedeutung, die die Sohnschaft Jesu von Anfang an in dieser Arbeit einnimmt, verwundert es, dass etwa von Larry W. Hurtado nur die zwei kleineren Bücher zum Thema, aber sein Hauptwerk, Lord Jesus Christ, gar nicht vorkommt. Auch bei Richard Bauckham fehlen seine Beiträge zur Christologie-Debatte; desgleichen fehlen Andrew Chester und William Horbury, die zur Messias- und Christusfrage im Sinne einer „High Christology“ ebenfalls Wichtiges beigetragen haben.
Gerade weil sich Rehfeld sehr intensiv auch mit Positionen und Autoren beschäftigt, die nicht eben geläufig sind, wäre ein Autorenregister sehr hilfreich gewesen. Auch ein Sachregister fehlt, einzig das Stellenregister hilft – neben einem ausführlichen Inhaltsverzeichnis – dem schnellen Nachschlagen.
Als Fazit bleibt am Ende ein etwas zwiespältiger Eindruck: In den verschiedenen Durchgängen durch das Markusevangelium finden sich eine Vielzahl von glänzenden Formulierungen, treffenden Beobachtungen und theologischen Tiefenbohrungen, die Freude machen (vor allem in Teil III: Christologische Grundlegung), aber – zumindest für den Rezensenten – dadurch entwertet werden, dass Rehfeld beständig die historische Rückfrage im Gestus theologischer Überlegenheit als unnötig und irreführend abweist. Die Folge ist, dass ich mir den Jesus, den er seinen Lesern vor die Augen malt, als historische Person aus Fleisch und Blut weder vorstellen noch (be)greifen kann. Aber gerade damit stellt diese Arbeit eine Provokation dar, der man sich nicht entziehen sollte.
Prof. Dr. Roland Deines, Prorektor und Professor für Biblische Theologie und Antikes Judentum an der Internationalen Hochschule Liebenzell