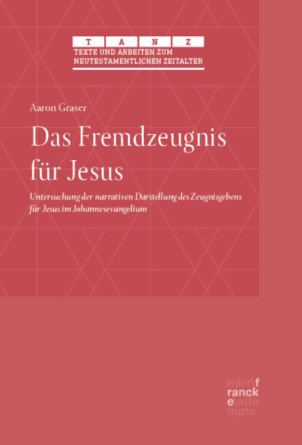Aaron Graser: Das Fremdzeugnis für Jesus
Aaron Graser: Das Fremdzeugnis für Jesus. Untersuchung der narrativen Darstellung des Zeugnisgebens für Jesus im Johannesevangelium, TANZ 71, Tübingen: Narr Francke, 2024, Pb., 365 S., € 118,–, ISBN 978-3-381-11001-8
Die Monographie des Pastors Aaron Graser wurde 2021 von der Universität Siegen im Fach Evangelische Theologie als Dissertation aufgenommen. Graser konzentriert sich nicht allein auf die juristischen Bezüge der Zeugnisthematik im Johannesevangelium, sondern er untersucht das „missionarisch-einladendes bzw. religiös motiviertes Zeugnisgeben“ (17). Dabei konzentriert er sich auf „die narrative Darstellung der Zeugen, der Zeugnisempfänger und des Akts des Zeugnisgebens“ (17).
Der ausführliche Forschungsüberblick (36 Seiten) sichtet relevante Forschungsstimmen zur Zeugnisthematik und skizziert auch den Ertrag der semantischen Studien zu den Begriffen μάρτυς κτλ., μαρτυρεῖν und μαρτυρία (46). Graser folgt anderen Forschern, die für das Zeugnisgeben im JohEv „vom rein forensischen Zeugnis hin zu einem Zeugnis für eine offenbarte Wahrheit“ plädieren (50.53). Die Notwendigkeit einer eigenen Untersuchung zur Zeugnisthematik im JohEv sieht er darin begründet, dass eine „differenzierte, detaillierte und ganz auf die Begriffe μαρτυρεῖν und μαρτυρία fokussierte Untersuchung der Darstellung des Zeugnisgebens im JohEv bislang noch nicht erfolgte“ (55).
Die Fragestellung der Monographie ist, „wie die Zeugnisgeber, die Zeugnisempfänger und der Akt des Zeugnisgebens dargestellt werden und welche
(Aus-)Wirkungen und Folgen die abgelegten Zeugnisse auf und für die a) unmittelbaren, erzählten primären Empfänger des Zeugnisses und b) für die intendierten Rezipienten des JohEv haben (sollten)“ (57). Methodisch setzt er dies durch eine narratologische Analyse (Finnern & Rüggemeier) sowie das kommunikativ-pragmatische Kategorieninventar der Gesprächsanalyse (Henne & Rehbock) um (58f).
Weil Graser nur explizite Stellen untersucht, wo die Lexeme μαρτυρεῖν und μαρτυρία erwähnt werden, eruiert er 40 Stellen in 15 unterschiedlichen Szenen durch 10 verschiedene Zeugen (65–70). Und weil er sich allein auf das Fremdzeugnis für Jesus beschränkt, werden schließlich elf Szenen und neun verschiedene Zeugen und ihr Fremdzeugnis für Jesus analysiert (71). Auffällig ist, dass er als „Figur“ des Zeugnisgebers auch Dinge bzw. Gegenstände (z. B. die Werke) wertet, auch wenn ihnen eine „Intentionalität im Sinne von mentalen Zuständen“ nicht zugesprochen werden kann (zur Diskussion vgl. 162). Nach der Analyse der elf Szenen (285 Seiten) folgt schließlich eine ausführliche „Zusammenfassung und Auswertung“ der Ergebnisse (36 Seiten), wobei der tabellarische Überblick der Ergebnisse den meisten Umfang einnimmt und eine Besonderheit darstellt (361–386). Ein Bibelstellen-, Literatur- und Tabellenverzeichnis werden am Ende dargestellt (396–429).
Die Studie von Graser stellt auf hervorragende Weise heraus und ist damit indirekt ein Korrektiv in der Forschung, dass allein nur drei Szenen prozessähnliche Umstände aufweisen. Dagegen stehen acht Szenen, die das „missionarisch-einladendes bzw. religiös motiviertes Zeugnisgeben“ betonen (393). Damit hebt Graser einmal mehr hervor, dass das Johannesevangelium zurecht in einzelnen älteren Forschungsbeiträgen als „Missionsschrift“ interpretiert worden ist (vgl. Andreas J. Köstenberger: The Missions of Jesus and the Disciples according to the Fourth Gospel, Grand Rapids: Eerdmans, 1998, 201f). Überraschend ist in diesem Zusammenhang, dass die Jünger von Jesus nur in einer Szene als Zeugnisgeber im gesamten Evangelium auftreten (306f). Graser interpretiert das Verb in Joh 15,27 als Imperativ und führt die zurückhaltende Darstellung der Jünger als Zeugnisgeber das noch bevorstehende Kommen des Geistes zurück (306). Der Verfasser stellt aber auch klar, dass die Funktion des Zeugen im gesamten Evangelium darin besteht, auf Jesus hinzuweisen und nach Erfüllung eines Auftrags in den Hintergrund zu treten (393).
Die wesentlichen Forschungsergebnisse trägt Graser in 12 Tabellen am Ende der Studie zusammen (361–386). Diese summarische Darstellung macht die Monographie transparent, die klare und stringente Struktur der Studie anschaulich, wirkt jedoch in Teilen etwas technisch. Letzteres wird insbesondere durch das „kommunikativ-pragmatische Kategorieninventar“ von Henne & Rehbock (58) bewirkt, wobei der inhaltliche Ertrag dieser Methode für das Gesamtergebnis überschaubar bleibt (389–391). In Bezug darauf ist das Johannesevangelium von großer Einheitlichkeit geprägt (390). Dennoch stellt die Monographie ein herausragendes Beispiel für eine konsequent narrative Lektüre und Analyse des vierten Evangeliums dar.
Dr. Alexander Drews, Dozent für Neues Testament, Praktische Theologie und Studienleiter, Biblisch-Theologische Akademie (BTA) Wiedenest