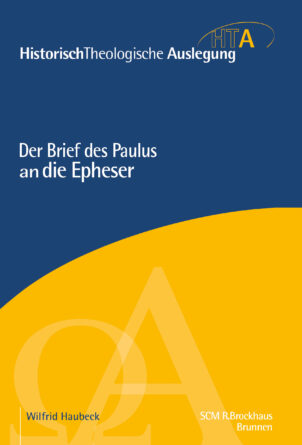Wilfrid Haubeck: Der Brief des Paulus an die Epheser
Wilfrid Haubeck: Der Brief des Paulus an die Epheser, HTA, Witten: SCM R. Brockhaus Verlag, 2023, 837 S., geb., € 69,−, ISBN: 9783417297409
Es ist sehr erfreulich, dass nun ein so ausführlicher Kommentar von theologisch höchster Güte zum Epheserbrief vorliegt. Ich gehe auf wesentliche Inhalte und Weichenstellungen in Haubecks Ausführungen ein.
Bei der Kommentierung des Eph ist die Verfasserfrage höchst kontrovers, in der deutschen Exegese wird Paulus meist abgelehnt. Dass ein evangelikaler Verfasser dennoch Paulus als Verfasser in Betracht zieht, wird nicht verwundern. W. Haubeck tut dies aber in einer sehr überzeugenden Art und Weise mit einer Fülle an Beobachtungen. Der Epheserbrief zeigt wenige persönliche Elemente, so als wenn Paulus die Adressaten nicht kannte bzw. der Brief richtet sich als Rundschreiben an mehrere Gemeinden im westlichen Kleinasien. Aber der Stil, besonders die Gebete und Lobhymnen zeigen die tiefe Anteilnahme des Paulus am Glauben der Briefempfänger. Aus dem hymnischen Stil ergibt sich manche Eigenart, die als nichtpaulinisch wahrgenommen wird, wie etwa die sich über viele Verse ziehenden langen Sätze im Griechischen. Auffällig sind im Eph etwa auch die vielen Hapaxlegomena. Dennoch ist Paulus als Autor, der in Rom im Gefängnis durch einen Mitschreiber unterstützt wird, die plausibelste Annahme. Andere Annahmen werden lange diskutiert und es wird deutlich, dass diese wenig Sinn machen.
W. Haubeck widmet der Frage der Pseudepigrafie noch ein eigenes Kapitel (55– 64), in dem er grundsätzliche Fragen diesbezüglich aufgreift, die Fachdiskussion in Grundzügen darstellt und zu dem Urteil kommt, dass Pseudepigrafie früher wie heute – wo sie als solche erkannt wurde und wird – kritisch gesehen und als Fälschung abgelehnt wird.
Ich finde gut, dass W. Haubeck, wenn ich ihn richtig verstanden habe, kein Hauptthema im Eph erkennt, und das neue Gottesvolk in Eph 2,11-20 oder die Waffenrüstung in Eph 6 nicht zum Zentrum erklärt. Bei aller ekklesiologischen Perspektive wird die Bedeutung von Jesus Christus entfaltet. Dies geschieht in allen Texten des Briefes, ohne einen eindeutigen Höhepunkt zu haben. Aber stattdessen sind mehrere wichtige Themen zu erkennen. Zu diesen zählen die Einheit der Christen, Liebe, christliche Lebensführung, christliche Identität in den Herausforderungen der geistlichen Welt und der Gesellschaft (77f.).
Allgemein tauchen in der Einzelexegese an vielen Stellen Parallelen und Verweise zur paulinischen Theologie auf, sodass man aus unserer heutigen Sicht kaum den Eph von Paulus wegschieben kann. Etwa auch bei der Frage nach der Rolle des Gesetzes, kommt es doch im Eph an der zentralen Stelle beim Verhältnis von Juden und Heiden in der Gemeinde vor. Die Ausführungen zum Gesetz Christi finde ich sehr gelungen. Demgegenüber empfinde ich das atl. Gesetz als noch zu positiv und immer noch zu bedeutsam für Christen dargestellt, sind die Christen ihm doch gestorben. Ist doch mit Christus große Freiheit entstanden, die aber von vielen Christen gleich wieder mit ethischen Richtlinien gefüllt wird.
Auch nimmt W. Haubeck eine richtige Perspektive ein, wenn er in Kapitel 4 die Apostel und Propheten nicht als Gestalten der Vergangenheit wahrnimmt, sondern gegen viele andere Ausleger darauf hinweist, dass im Text nichts darauf hindeutet, sondern die genannten fünf Dienste allesamt in den Adressatengemeinden und deren Umfeld zu finden sind (463). W. Haubeck sieht außerdem in Aposteln, Evangelisten usw. keine Ämter, sondern Funktionen einzelner Christen. Zudem geht es um Dienst ohne hierarchische Struktur (469). Die Apostel damals waren in der Kirchengeschichte einmalige Gestalten mit einmaligem Auftrag, die Gemeinde im Evangelium und Gottes Willen zu gründen. Ich sehe aber keinen Grund, warum die fünf Dienste in Eph 4 heute nicht mehr so ähnlich vorhanden sein sollen. Als Parallele gibt Haubeck 1. Kor 12 und Römer 12 an. Ich würde von einem apostolischen Dienst sprechen, nicht von Aposteln, der aber natürlich auch heute noch gebraucht wird, um etwa neue gesunde Gemeinden zu gründen. Exegetisch bedeutsam im Zusammenhang des 4. Kapitels: W. Haubeck sieht in dem Hinabsteigen von Christus nicht den Gang ins Totenreich, sondern seine Menschwerdung (wie im Philipperhymnus, wegrückend von 1. Petr), in seinem Hinaufsteigen seine Erhöhung zur Rechten Gottes.
Im vieldiskutierten Abschnitt Kapitel 5,21-33 zum Verhältnis von Mann und Frau arbeitet W. Haubeck einzigartige und damals neuartige Gedanken von Paulus zum Thema Liebe und Partnerschaft heraus. Die Liebe der Ehemänner sowie deren christologische Begründung und Brautmetaphorik waren im damaligen hellenistischen Kontext etwas Neues. Die viel umfangreichere Ermahnung an die Männer bildet den Hauptaussage und fordert die Männer nicht zum Beherrschen der Frau auf. Unterordnung der Frau (nur ihrem eigenen Mann gegenüber, nicht generell allen Männern) geschieht im Vertrauen, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, welches nicht erzwungen werden kann. Die Liebe (Agape) kann als die in V.21 geforderte Unterordnung des Mannes unter die Frau verstanden werden. Da das Vorbild von Jesus Christus immer das gegenseitige Dienen ist, geht es in der Ehe nie um Hierarchie und Herrschaft, dies würde auch ihr missionarisches Zeugnis heute beeinträchtigen.
Kapitel 6 richtet den Blick auf die dämonische geistliche Welt als Herausforderung für die Christen. Die Waffenrüstung wird durch alttestamentliche Textbezüge erklärt und eher als defensiv gewertet, wobei dem Schild des Glaubens eine besondere Rolle zukommt. Nur das Schwert des Geistes ist offensiv zu verstehen. Wir haben es nicht mit einer besonderen Aufgabe oder Anstrengung der Christen zu tun, auch bietet der Abschnitt keine Sonderlehre. Vielmehr geht es hier um ein Leben in der Gemeinschaft mit Christus, was den Adressaten bildhaft vor Augen geführt wird.
Franz Mußner moniert in seinem ÖTK-Kommentar zum Eph, dass zu diesem Paulusbrief immer noch wenig zur Pneumatologie geforscht wurde. Diese Lücke schließt W. Haubeck durch eine Vielzahl an Ausführungen (z. B. 159-161; 182-184; 509; 533f.; 591f. uvm.). Es ergibt sich ein umfassendes Bild vom Heiligen Geist, dem Geist der Weisheit und Offenbarung, der die Gläubigen stark macht, sie versiegelt hat, die neue Identität in Christus schenkt (Kap. 1-3) und zu einem Leben für Christus befähigt (Kap. 4-6).
Ich selber halte immer noch für sehr wahrscheinlich, dass es sich beim Epheserbrief um den Brief nach Laodizäa handelt (Kol 4,16; der Eph hatte ja ursprünglich keine Verfasserangabe). Bei der Annahme, dass der Eph, Kol und Phlm eng zusammengehören, der Eph aber nicht der Laodizäabrief ist (so auch Haubeck), müsste man noch von einem vierten Brief ausgehen, der mit den genannten im Zusammenhang steht. Da liegt es näher, dass der von Paulus erwähnte Brief der Eph ist, auch wenn Laodizäa um 61 n. Chr. zerstört wurde (vgl. 81; die Stadt bzw. Gemeinde wird in Offb 3 ja trotzdem ebenfalls prominent erwähnt). Der anonyme Stil des Eph, der keine persönliche Beziehung von Paulus zu den Adressaten erkennen lässt, weist eher auf eine unbekanntere Gemeinde aus dem Hinterland, keinesfalls auf eine Gemeinde in einer Metropole wie Ephesus, wo man mehr Möglichkeiten hatte, um noch lange intensiv mit Paulus in Kontakt zu stehen.
Auffallend spitzfindig und fair sowie ohne Polemik ist der Umgang W. Haubecks mit anderen theologischen Meinungen. Die Auslegung wirkt an keiner Stelle einseitig, überzogen oder interessengelenkt in Schemata gepresst. Sehr häufig werden bei schwierigen Entscheidungen in der Auslegung viele Meinungen zitiert, deren Vor- und Nachteile benannt. Haubecks Schlüsse finde ich tatsächlich immer überzeugend und nachvollziehbar. Der Epheserbrief erstrahlt durch die Auslegung als das, was er ist: ein in sich höchst stimmiges Werk mit vielen tiefen Glaubenswahrheiten aus der Mitte der paulinischen Theologie, vielleicht auch als Höhepunkt paulinischen Denkens, wenn auch die Christologie einen sehr ekklesiologischen Fokus hat. Bei aller theologischen Tiefe der Ausführung habe ich mich – wenn ich das hier sagen darf – auch des Öfteren beim Lesen geistlich sehr erbaut gefühlt.
Wilfrid Haubeck bereichert die HTA-Reihe mit seinem Kommentar zum Epheserbrief um eine weitere theologische Perle. Die Auslegung zeugt von einer großen Reflexion und tiefen Beschäftigung mit dem Epheserbrief sowie der gesamten paulinischen Theologie und spiegelt letztlich das Lebenswerk des Autors ein Stück wider. Der Leser kann sehr dankbar sein für die Fülle an Material und Themen, die entlang der Auslegung präsentiert werden.
Phil Jordan, Religionslehrer, Theologe (Master), Doberlug-Kirchhain