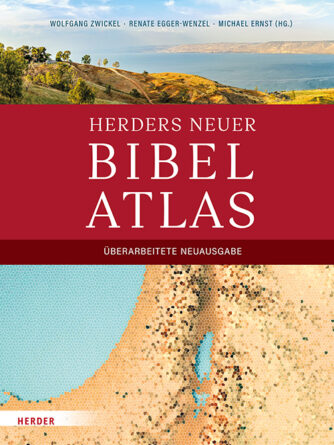Wolfgang Zwickel / Renate Egger-Wenzel / Michael Ernst (Hg.), Herders neuer Bibelatlas
Wolfgang Zwickel / Renate Egger-Wenzel / Michael Ernst (Hg.), Herders neuer Bibelatlas. Überarbeitete Neuausgabe, Freiburg im Breisgau: Herder, 2023, geb., 399 S., € 68,–, ISBN 978-3-451-39450-8
Die Entstehungs- bzw. Vorgeschichte des hier angezeigten Bibelatlasses begann im Jahre 1987 mit dem Erscheinen des von James B. Pritchard herausgegebenen The Times Atlas of the Bible. Hiervon kam dann 1989 als Herders großer Bibelatlas eine deutsche Ausgabe bzw. Bearbeitung heraus, für die Othmar Keel und Max Küchler verantwortlich zeichneten. 2013 präsentierten Wolfgang Zwickel, Renate Egger-Wenzel und Michael Ernst unter dem Titel Herders neuer Bibelatlas einen tatsächlich völlig neuen Bibelatlas. Dass dieser mit seinem im Hause Herder erschienenen Vorgänger – vom ähnlichen Buchtitel abgesehen – nicht viel zu tun hat, wird bereits dadurch deutlich, dass letzterer weder im Vorwort noch im Literaturverzeichnis (vgl. die Rubrik „Atlanten“) erwähnt wird.
Zehn Jahre später ist der 2014 mit dem „Irene Levi-Sala Prize for Books on the Archeology of Israel” ausgezeichnete Herders neuer Bibelatlas nun in einer „überarbeiteten Neuausgabe“ erschienen. Das Herausgeber- und Autorenteam ist identisch mit dem der Erstauflage. In den AfeT-Rezensionen sollte nicht unerwähnt bleiben, dass mit Pieter G. van der Veen auch ein Autor mitgewirkt hat, der dem evangelikalen Spektrum zuzuordnen ist.
Herders neuer Bibelatlas bietet ungefähr 200 Landkarten, 30 Stadtpläne, 35 Gebäudegrundrisse, 25 Schaubilder, 35 Tabellen, 30 Zeittafeln, 100 Fotos von Landschaften, Grabungsstätten und Gebäuden sowie rund 210 weitere Fotos (und ca. 30 Zeichnungen) von archäologischen Fundstücken. In ausführlichen und lehrreichen, jeweils doppelseitigen und in Spalten gedruckten Begleittexten erläutern die Autorinnen und Autoren zudem das Karten- und Bildmaterial. Auf den unteren Rändern seiner linken bzw. geraden Seiten wird der Atlas von einer Zeitleiste durchlaufen, die die historische Einordnung erleichtert.
Der Atlas enthält somit eine Fülle von wertvollen Informationen, die sowohl im Bibelstudium als auch bei der Veranschaulichung biblischer Texte eine wertvolle Hilfe darstellen. So überrascht es nicht, wenn das Herausgeberteam im Vorwort feststellt, dass der Atlas „zu einem gut eingeführten Standardwerk im Bereich der theologischen Wissenschaften, aber auch in der Gemeinde- und Schulpraxis geworden“ ist (9).
Auf dem Rückdeckel des Atlasses wird wiederholt betont, dieser sei „auf dem neuesten Stand (der Forschung)“. Die Tatsache, dass das Literaturverzeichnis (344–345) im Vergleich mit dem der Erstauflage unverändert geblieben ist, lassen jedoch Zweifel an dieser Aussage aufkommen. Zutreffend ist dagegen, was das Herausgeberteam im Vorwort schreibt: „Für die hier nun vorliegende 2. überarbeitete und verbesserte Auflage wurden Fehler korrigiert sowie viele Pläne und Karten verbessert oder neu gestaltet“ (9).
So werden bei einem parallelen Durchblättern von Erst- und Neuauflage sofort die in der Tat beträchtlichen Unterschiede in der Aufmachung ersichtlich. Während Stadtpläne und Grundrisse früher einfarbig (bzw. in verschiedenen Tönen einer Farbe) gestaltet waren, erscheinen sie nun mehrfarbig, was die Zuordnung der in den betreffenden Legenden gebotenen Zeichen- und Farberklärungen maßgeblich erleichtert. Gewässer wie Flüsse, Kanäle, Wassergräben und Hafenbecken sind nun nicht mehr weiß oder grau, sondern durchgehend blau eingezeichnet. Im Grundriss des Jerusalemer Tempels (297) wurden (wohl aufgrund von Ex 20,26) beim Brandopferaltar die in der Erstauflage eingezeichneten Treppenstufen weggelassen.
Der Plan vom Forum Romanum wurde durch einen völlig neuen ersetzt (264), wobei das hier wiederum eingezeichnete Kolosseum erst unter den flavischen Kaisern Vespasian und Titus erbaut wurde (ca. 72–80 n. Chr.) und somit zur Zeit von Jesus bzw. Paulus noch nicht bestand. Die Fotos von Samaria (148) und vom Grabmonument des Perserkönigs Kyrus II. im iranischen Pasargadae (195) wurden durch geeignetere ausgetauscht. Die beiden Fotos (71) vom sog. Burney-Relief und von einem assyrischen Metallhelm waren in der Erstauflage überhaupt noch nicht vorhanden.
In einer Hinsicht offenbart das Nebeneinanderlegen der beiden Atlanten allerdings auch eine Verschlechterung der Neu- im Gegensatz zur Erstauflage. Während Landkarten sich hier nämlich noch durch eine deutliche und volle Farbgebung auszeichneten, erscheinen sie nun in eher faden und tristen Tönen. Das wird besonders deutlich, wenn man sich vor Augen hält, dass die satten Grünflächen der Erstauflage nun einem matten Graugrün gewichen sind.
Der Atlas gliedert sich in vier Hauptteile. Den Anfang macht die „Landeskunde“ (10–29), wobei hier speziell „das ‚Land der Bibel‘ oder – geografisch ausgedrückt – die südliche Levante bzw. das West- und Ostjordanland“ (18) im Blick ist. Von diesem Gebiet, welches im Laufe der Geschichte unterschiedliche Bezeichnungen trug, werden Klima, Topografie, Flora und Fauna sowie Handwerk, Gewerbe und Handel auf verständliche Art und Weise erörtert.
In Bezug auf die Nord-Süd-Ausdehnung des Landes wird wiederholt auf die biblische Formel „von Dan bis Beërscheba“ (vgl. Ri 20,1; 1Sam 3,20; 2Sam 3,10; 1Kön 5,5) verwiesen (11–12), wobei alternative und sich z.T. auch auf eine (idealisierte) West-Ost-Ausdehnung beziehende biblische Angaben (Gen 15,18; Deut 11,24; Jos 1,4) im gesamten Atlas nicht diskutiert (siehe aber 104 zu Jos 1,4), geschweige denn kartografisch aufbereitet werden (vgl. Boris Paschke: „The Land in the New Testament“, in: Hendrik J. Koorevaar / Mart-Jan Paul[Hg.], The Earth and the Land: Studies about the Value of the Land of Israel in the Old Testament and Afterwards, Edition Israelogie 11, Berlin: Peter Lang, 2018, 292–294).
Im zweiten Hauptteil weitet sich der Blick des Atlasses. Unter der Überschrift „Der vordere Orient im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr.“ (30–73) geht es nun um die landeskundliche Beschreibung von Ägypten und Ugarit, des Hetiterreiches, der Ägäis und Mesopotamiens, wobei jeweils auch historische, politische und religiöse Gesichtspunkte Berücksichtigung finden.
Der dritte Hauptteil ist mit „Altes Testament“ (74–261) überschrieben und nimmt seitenmäßig etwa die Hälfte des Atlasses ein. Trotz des historisch-kritischen Ansatzes (74) orientiert sich die Darstellung am kanonischen Aufbau und somit auch an der Erzählfolge des Alten Testaments. In dem von ihm verfassten Abschnitt zur „Landnahme nach der Darstellung des Josuabuches“ weist Wolfgang Zwickel wiederholt (und vor allem im Hinblick auf die Eroberung Jerichos) darauf hin, dass er die betreffenden biblischen Texte – zu denen im Atlas entsprechende Landkarten geboten werden – nicht als historische Tatsachenberichte betrachtet (104–107).
Die Landschaft Peräa ist in allen betreffenden Landkarten (237, 241, 283) ungenau und zu klein eingezeichnet, da sie sich östlich des Jordans von Pella im Norden bis Machairus im Süden sowie in östlicher Richtung bis Philadelphia erstreckte (Flav. Jos. Bell. III 46; vgl. Boris Paschke: „Peräa“, in: Heinzpeter Hempelmann / Uwe Swarat (Hg.), ELThG2: Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde, Neuausgabe, Bd. 3, Holzgerlingen: SCM R. Brockhaus, 2024, Sp. 1354–1355).
Der letzte Hauptteil trägt die Überschrift „Neues Testament“ (262–321) und beginnt mit der Darstellung der geografischen, politischen und religiösen Umwelt des Lebens Jesu und der neutestamentlichen Schriften, denen dann ein eigener Abschnitt gewidmet ist. Auch auf die Zeit nach dem Neuen Testament (bis ca. 300 n. Chr.) wird kurz eingegangen.
Während die Reisen des Apostels Paulus auf mehreren Karten nachgezeichnet werden (304–309), findet sich zu den von Jesus (und seinen Jüngern) zurückgelegten Wegstrecken keine einzige Karte im Atlas (vgl. dagegen Tim Dowley [Hg.]: Atlas. Bibel und Geschichte des Christentums, Wuppertal: R. Brockhaus, 1997, 60–65).
Die Karte zur Romreise des Paulus (309) ist im Hinblick auf das Geschehen auf und rund Kreta recht ungenau. Es entsteht nämlich der Eindruck, Paulus sei bei Salmone (d. h. am heutigen Kap Sideros) an Land gegangen (vgl. jedoch Apg 27,7–8). Die südlich von Kreta gelegene Insel Kauda ist auf der Karte kaum auszumachen und wurde nach Apg 27,16 wohl dichter ‚umsegelt‘ als im Atlas vermittelt. Es hätte sich somit angeboten, von der Insel Kreta und ihrer Umgebung (inkl. Kauda) eine eigenständige und großmaßstäbige Karte zu präsentieren.
In einem Anhang (322–343) wird die Methodik des Atlasses hinsichtlich Kartografie, Archäologie, Chronologie, Philologie, Ikonografie und Hermeneutik erläutert. Abgerundet wird das Werk durch ein Literaturverzeichnis, Personalia, Abkürzungs- und Abbildungsverzeichnis sowie Ortsnamen- und Stellenregister (v. a. Bibel und Flavius Josephus).
Das umfangreiche, von Wolfgang Zwickel erstellte Ortsnamenregister (350–390) ist besonders hilfreich, weil hier zu den meisten der rund 2800 Einträge auch die entsprechenden Koordinaten nach dem Old Palestine Grid und dem WGS84-Grid angegeben sind. Die von mir mittels Google Earth durchgeführten Stichproben lassen vermuten, dass die angegebenen Koordinaten im Großen und Ganzen korrekt sind.
Nachdrücklich zu betonen ist, dass die in dieser Rezension geäußerten Kritikpunkte nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass Herders neuer Bibelatlas eine wahre Fundgrube für all jene ist, die mit der Exegese oder anschaulichen Vermittlung biblischer Texte befasst sind. Von den im Atlas gebotenen Karten, Abbildungen und Informationen wird man vermutlich ein Leben lang zehren, lernen und profitieren können, weshalb sich die Anschaffung dieses hochwertigen und großformatigen Buches, zumal bei einem so guten Preis-Leistungs-Verhältnis, allemal lohnt.
Das Herausgeberteam drückt im Vorwort folgenden Wunsch aus: „Wir freuen uns, wenn der Bibelatlas auch in Zukunft Studierenden, aber auch allen anderen an der Bibel Interessierten als nützliches und informatives Hilfsmittel für das Verständnis der biblischen Texte und ihrer Welt dient“ (9). Diesem Anspruch wird Herders neuer Bibelatlas auch in seiner überarbeiteten Neuausgabe ohne Zweifel gerecht werden, da es sich hierbei um ein äußerst wertvolles, zuverlässiges und nutzerfreundliches Werkzeug handelt.
Dr. Boris Paschke, Guest Associate Professor of New Testament, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgien