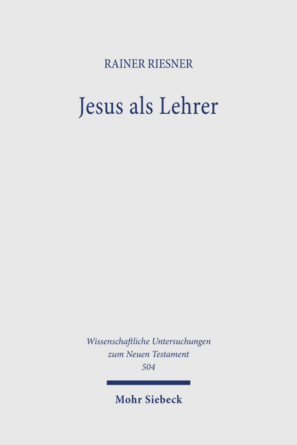Rainer Riesner: Jesus als Lehrer
Rainer Riesner: Jesus als Lehrer. Frühjüdische Volksbildung und Evangelien-Überlieferung. 4., vollst. neubearb. Aufl., WUNT 504, Tübingen: Mohr Siebeck, 2023, Pb., 864 S., € 129,–, ISBN 978-3-16-162497-1
Rainer Riesners Jesus als Lehrer ist ein monumentales Werk, das in der vierten Auflage die bisherigen Auflagen 1981, 1983 und 1988 vertieft und erweitert. Der emeritierte Professor für Neues Testament an der Universität Dortmund legt eine umfassende Monographie vor, die die Rolle Jesu als Lehrer im Kontext der frühjüdischen Volksbildung und der Evangelienüberlieferung untersucht: „Die Rückfrage nach einem möglichen Ursprung der Evangelien-Überlieferung bei Jesus selbst ist das Hauptthema der vorliegenden Untersuchung“ (158). Und es gehe um „die Rolle, die Lehren und Lernen der Sache nach in der vorösterlichen Verkündigungssituation Jesu gespielt haben … [und] um die äußere, sozusagen ‚technische‘ Seite der Verkündigung Jesu“ (182).
Riesner gliedert sein Werk in fünf Hauptkapitel, die sich mit der Jesus-Überlieferung, der frühjüdischen Volksbildung, der Lehrautorität Jesu, seiner öffentlichen Lehre und der Jüngerlehre befassen. Entgegen der 3. Aufl. (1988) wird das ca. 20 seitige Nachwort in den Haupttext eingearbeitet. Die Zusammenfassung am Schluss bleibt mit ca. vier Seiten überschaubar.
Im ersten Kapitel „Die Jesus-Überlieferung“ plädiert Riesner für ein komplexes Modell zur Erklärung der synoptischen Frage und stellt fest, dass einfache Lösungen wie die Zwei-Quellen-Theorie nicht überzeugen (4–9). Vielmehr müsse von einem breiten Traditionsstrom ausgegangen werden, bei dem sowohl mündliche als auch schriftliche Überlieferungsvorgänge berücksichtigt werden (10–12). Riesner stellt die These auf, dass die mündliche Tradition eine bedeutende Rolle gespielt hat und dass nur ein „komplexes Modell“, das möglichst viele Einzelphänomene einbezieht, die synoptische Frage hinreichend (er)klären kann (127f).
Daher ist die in die Evangelien eingemündete Jesus-Überlieferung „im engen Kontakt mit den Augen- und Ohrenzeugen erfolgt“ (139). Riesner setzt sich kritisch mit der klassischen Formgeschichte auseinander und problematisiert deren Grundannahmen wie die Propheten-Hypothese, das kollektivistische Literaturverständnis, die Vorstellung von zeitlosen Überlieferungsgesetzen und das Konzept „reiner Formen“ (16–28). Diese Kritik mündet in einer differenzierten Auseinandersetzung mit neueren Ansätzen wie der Third Quest for Jesus und dem Konzept des social memory (30–34).
Für die Zuverlässigkeit der vorsynoptischen Jesus-Überlieferung identifiziert Riesner sieben Gruppen von Akteuren, die sich an einer „gepflegten Überlieferung“ beteiligt haben: Petrus, die Zwölf und die Jerusalemer Urgemeinde; die Großfamilie Jesu, die „Hebräer“ und galiläische Frauen; der johanneische Kreis; Matthäus und das Judenchristentum; die „Hellenisten“ und Antiochien; die bekehrten Priester und der Levit Barnabas; sowie Paulus, seine Mitarbeiter und Gemeinden (98–119). Damit entwirft er ein differenziertes Szenario des Überlieferungsprozesses, der nicht primär in den „Studierstuben der Evangelisten“, sondern im Verkündigungsalltag und Leben der Gemeinden stattgefunden hat (119–123). So postuliert er mit E. A. Judge, K. Haacker, C. K. Barrett eine Kontinuität „zwischen der späteren Gestaltwerdung der urchristlichen Gemeinden und dem Auftreten Jesu“ (139). Riesner möchte dann im Folgenden begründen, dass Jesus selbst als messianischer Lehrer dieses „Traditionskontinuum zwischen der vor- und nachösterlichen Zeit“ initiiert hat (140).
Im zweiten Kapitel „Die Frühjüdische Volksbildung“ untersucht Riesner die drei jüdischen „Volksbildungstraditionen“: das Elternhaus, die Synagoge und die Elementarschule (189–314). Diese Analyse ist wichtig, um die Bildung Jesu zu verstehen, die keine höhere schriftgelehrte Ausbildung, aber dennoch ein großes Maß an biblischem Wissen und Traditionstechnik umfasste (185). Riesner zeigt, dass Jesus in seiner Lehre sowohl frühjüdische als auch hellenistische Bezüge aufgenommen hat, wobei die alttestamentlichen Traditionen prägend blieben (373). Als Ergebnis hält der Verfasser fest: Jesus habe gemäß den ältesten Quellen keine ‚höhere‘ schriftgelehrte Ausbildung besessen. Dennoch sicherten ihm das Aufwachsen und die Verwurzelung im jüdischen Milieu Galiläas ein umfangreiches biblisches Wissen sowie solide Exegese- und Traditionstechniken, so dass er sich mit kundigen Schriftgelehrten messen konnte.
Das dritte Kapitel „Die Lehrautorität Jesu“ widmet sich dem Autoritätsanspruch Jesu, der mit seinem Wirken als Lehrer verbunden ist (375). Riesner argumentiert, dass die häufige Anrede Jesu als „Lehrer“ in den Evangelien historischen Wert hat. Dass Jesus auch sich selbst als Lehrer bezeichnet habe, zeigt Riesner in der Interpretation verschiedener Stellen (Mt 26,18/Mk 14,14/Lk 22,13, Mt 10,24–25/Lk 6,40 sowie Mt 23,8–10; 383–391). Neben seiner Rolle als Lehrer werde Jesus auch als Prophet gesehen, der in der Tradition der alttestamentlichen Propheten stehe. So hat Jesus „die Zentralgedanken seiner Verkündigung in kurze, poetisch geformte Worte gefasst, die leicht memoriert werden konnten“ (419–420). Besondere Aufmerksamkeit widmet Riesner den frühjüdischen Messiaserwartungen (420–465). Er kommt zu dem Schluss, dass Jesus sich als messianischen Weisheitslehrer gesehen und seinen Worten höchste Autorität zugeschrieben habe. Darin lag für die Jüngergruppe, besonders für den Zwölferkreis, ein „außerordentliches Überlieferungsmotiv“ (466).
Im vierten Kapitel „Die Öffentliche Lehre“ wird die Verkündigung Jesu vor den Volksmengen beleuchtet. Er stellt fest, dass Jesu Wanderpredigt ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber zeitgenössischen Protorabbinen darstellte (469). Jesus habe im Wesentlichen in einprägsamen, bildhaften und kurzen Lehrsummarien wiederholend gelehrt, wie es in Schulen des Altertums üblich war (475–476). Bemerkenswert ist, dass Jesus mindestens 75% seiner Lehre auf Anhänger konzentriert habe, während verhältnismäßig wenig Lehre sich an die ablehnende Menge oder Gegner richtete (477–478). Hinsichtlich der verwendeten Sprache Jesu nimmt Riesner die jüngste Forschungsdiskussion auf, die von einer „trilingualen Situation zur Zeit Jesu“ (Hebräisch, Aramäisch, Griechisch) ausgeht (497–498). Er postuliert, dass Jesus in Galiläa Aramäisch verwendete, in Judäa und religiösen Kontexten wohl Hebräisch und im Kreis griechisch sprechender Juden in Jerusalem auch Griechisch (513). Die Fülle mnemotechnischer Mittel lasse nur einen Schluss zu: „dass es sich um bewusst zum Behalten geformte, didaktische Stoffe handelt“ (529).
Im fünften Kapitel „Die Jüngerlehre“ argumentiert Riesner, der Jüngerkreis Jesu stelle im Vergleich zu zeitgenössischen Beispielen und der nachösterlichen Gemeinde eine „in dieser Art unwiederholbare Gemeinschaft“ dar (548). Die Traditionsbildung sieht Riesner insbesondere in Worten an die Jünger, in der Lebensweise mit Jesus (552–558) und in ausführlichen Meister-Jünger-Gesprächen (559–573) begründet. Er argumentiert, dass dieser Jüngerkreis – eine weite und funktionale Definition vorausgesetzt – durchaus als „Schule Jesu“ bezeichnet werden kann (574). Riesner hält mit der Mehrheit der Exegeten an der Historizität der Aussendung der Jünger durch Jesus fest (577). Die Aussendung sei ein entscheidendes Datum der vorösterlichen Traditionsbildung gewesen (578), wobei das Ziel das Bewahren der Worte Jesu war. Man kann daher in der Aussendung eine Katalysatorfunktion für „eine erste bewusstere Weitergabe von Erzählungen über Jesus“ sehen (593).
Was ist neu in der vierten Auflage? Der Haupttext wurde um etwa 18% erweitert (von 520 auf 636 Seiten), während die Bibliographie von 79 auf 176 Seiten angewachsen ist. Riesner trägt eine beeindruckende Fülle der deutschsprachigen, französischen und angelsächsischen Literatur zusammen und referiert an entscheidenden Stellen auch die jüngsten Forschungsergebnisse. Der Gesamteindruck des Werkes ist, dass die Tradenten der „Worte und Taten des Herrn“ durchweg ein besonderes konservierendes Interesse aufweisen und die Überlieferung insgesamt als verlässlich einzustufen ist (vgl. Lk 1,1–4). Viele ‚alten‘ Thesen der Formgeschichte oder eines einseitig konstruktivistischen social memory approach werden mit ausgewogenen Argumenten zurückgewiesen.
Riesners Werk zeichnet sich durch eine „kritische Sympathie“ (Werner Georg Kümmel) gegenüber der synoptischen Tradition aus und begründet sachlich und überzeugend, warum man den synoptischen Evangelien vertrauen kann. Es gehört zu den Verdiensten dieser Monographie, dass sie forschungsgeschichtliche Irrwege offengelegt und grundsätzlich für ein Zutrauen in die synoptische Evangelienüberlieferung geworben wird.
Mit Jesus als Lehrer legt Riesner ein beeindruckendes opus magnum vor, das nicht nur die neutestamentliche Forschung zur Traditionsbildung zusammenfasst und kritisch würdigt, sondern auch eigenständige und gut begründete Thesen zur Lehrautorität Jesu, zur frühjüdischen Volksbildung und zur Evangelienüberlieferung darstellt. Das Werk ist ein unverzichtbarer Beitrag zur neutestamentlichen Wissenschaft und wird für die Frage nach dem Leben Jesu auf lange Sicht maßgeblich bleiben. Riesners detaillierte Untersuchung der frühjüdischen Bildungspraktiken und seiner Methoden der Traditionsbildung macht dieses Werk zu einer unverzichtbaren Ressource für interessierte Theologen und Historiker.
Dr. Alexander Drews, Dozent für Neues Testament und Praktische Theologie sowie Studienleiter, Biblisch-Theologische Akademie (BTA) Wiedenest