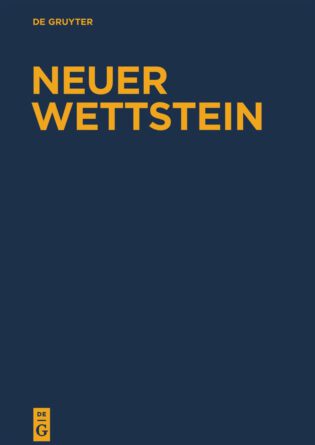Udo Schnelle / Manfred Lang(Hg.), Neuer Wettstein
Udo Schnelle / Manfred Lang(Hg.), Neuer Wettstein. Texte zum Neuen Testament aus Griechentum und Hellenismus. Bd. I/1.2. Texte zum Matthäusevangelium. Teilband 2. Matthäus 11–28, Berlin/Boston: de Gruyter, 2022, geb., VIII+1169 S., € 210,–, ISBN 978-3-11-024744-2
Der vorliegende Band ist der insgesamt 6. Band des sogenannten ›Neuen Wettstein‹ (abgekürzt NW), die seit 1996 erschienen sind, und der zweite Teilband zum Matthäusevangelium. Der erste zu Mt 1–10 erschien 2013. Mit knapp 1200 Seiten bringt er die Mt-Kommentierung innerhalb des ›Neuen Wettstein‹ zum Abschluss. Nun fehlen nur noch die Bände zum lukanischen Doppelwerk, um dieses 1986 von Georg Strecker (1929–1994) in Göttingen initiierte Projekt zu vollenden. Im Rahmen meiner Rezension des ersten Teilbandes zu Matthäus habe ich die Geschichte und Intention dieses Unternehmens ausführlich vorgestellt (s. JETh 28 [2014], 232–241, https://jeth.digitheo.de/ojs/index.php/jeth/article/view/108805/107363), so dass ich mich hier auf das Wesentliche beschränken kann. Der Namengeber für den ›Neue(n) Wettstein‹, der aus Basel stammende aber von dort vertriebene Johann Jakob Wettstein (1693–1754), veröffentlichte 1751/52 eine 2-bändige griechische NT-Ausgabe, die umfangreiche Paralleltexte aus der gesamten antiken (einschließlich der patristischen) Literatur anführte, um die neutestamentlichen Texte philologisch und historisch besser zu verstehen. Eigentlich war es seine Absicht, mit diesem weitläufigen Material eine zuverlässigere Basis für textkritische Entscheidungen zu treffen. Aber die neutestamentliche Textkritik entwickelte sich methodisch in der Richtung weiter, die sein Zeitgenosse und Konkurrent in textkritischen Fragen, Johann Albrecht Bengel (1687–1752), begründet hatte. Diese literarische Kontextualisierung der neutestamentlichen Schriften zugunsten einer stärker historischen und religionsgeschichtlichen Einordnung begann in der zweiten Hälfte des 16. Jh.s. An ihrem Anfang steht der Humanist Joachim Camerarius (1500–1574) mit seinem Werk Commentarius in Novum Foedus: In quo et figurae sermonis, et verborum significatio, et orationis sententia, ad illius Foederis intelligentiam certiorem, tractantur, das erstmals 1572 erschien. Hugo Grotius (1583–1645) schließlich hat mit seinen Annotationes in libros Evangeliorum (Amsterdam 1641) dieser Kommentarmethode, die das Neue Testament unter Rückgriff auf antike Quellen erklärte (sog. Observationes-Literatur), maßgeblich zum Durchbruch verholfen. Die Textausgabe von Wettstein bildet in gewisser Weise den Abschluss dieser ersten Sammelphase, die dann im 20. Jahrhundert mit dem Werk von Paul Billerbeck (das durch die Unterstützung von H. L. Strack veröffentlicht werden konnte, darum der Name Strack-Billerbeck) einen neuen Aufschwung nahm. Das im April 2024 gestartete Projekt Corpus Judaeo-Hellenisticum Novi Testamenti digital (https://cjhnt-info.saw-leipzig.de/de) führt diese Idee mit der Methodik und den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts weiter.
Insgesamt bietet der vorliegende Band ca. 2000 Textbelege aus der griechisch- und lateinischsprachigen Umwelt des Neuen Testaments, dazu ca. 440 Verweise auf Belege, die in den bereits vorliegenden Bänden bearbeitet wurden. In Seiten gemessen sind es genau 1033 Seiten, dazu kommen umfangreiche Anhänge und Indices: ein Verzeichnis der Stellen der antiken Autoren, ein Stichwortregister, das „noch einmal deutlich erweitert und mit weiterführenden Unterteilungen differenziert“ wurde (Vorwort S. V), sowie als Index III eine Liste, die überblicksartig alle zu den jeweiligen Mt-Stellen genannten antiken Belege aufführt. Das ist zunächst einmal sehr eindrucksvoll und soll im Folgenden auch gewürdigt werden, aber die formalen Schwächen der übrigen Bände sind auch im vorliegenden beibehalten worden, was die Benützbarkeit unnötig erschwert. So fehlen nicht nur Begründungen für die Auswahl der gebotenen Texte, sondern auch Kontextualisierungen und Hinweise auf Verfasser, Entstehungszeit und Genre des zitierten Textes. Die sehr kurzen Einleitungen (zumeist 1–2 Zeilen) sind oftmals ebenso kryptisch wie die Abkürzungen für Autoren und Werke. Manche Texte und Autoren werden häufiger zitiert, da hätte es sich empfohlen, die Einleitungen aufeinander abzustimmen, aber das ist nicht der Fall. Das zeigt u.a. eine Cicero-Stelle, die versehentlich zweimal zitiert wird (907 und 918), aber mit unterschiedlicher Einleitung (im Register sind beide Stellen vermerkt, spätestens da hätte die Doppelung eigentlich auffallen können). Da für die Stellenangaben jeweils eine eigene Zeile reserviert wird, wäre es ein Leichtes gewesen, statt „Sen Herc F 1063–1081“ (782) zu schreiben: „Seneca d. Jüngere (oder: Lucius Annaeus Seneca), Hercules furens“ und dann als weitere Information etwa in Klammer: (lat. Tragödie, Mitte 1. Jh. n. Chr.). Da die Abkürzungen nicht aufgelöst werden, wenn sie schon einmal in einem der vorigen Bände vorgekommen sind (nur neu aufgenommene Quellenschriften werden verzeichnet, s. 1037–1040), braucht man Zugriff auf die früheren Bände, um an die nötigen Informationen zu kommen (etwa auch bezüglich der verwendeten Textausgaben und Übersetzungen). Auch da könnte den Nutzern leicht geholfen werden, indem die nötigen Dateien auf der Projekthomepage zum Download zur Verfügung gestellt werden: Aber wie es aussieht wird diese Seite nicht mehr aktualisiert (https://www.theologie.uni-halle.de/nt/corpus-hellenisticum/226905_226953/nw/ [angesehen am 30.3.2025; der letzte Eintrag ist vom Februar 2018]). Es ist einfach schade, dass der Gebrauch dieses so nützlichen Werkzeugs so unnötig erschwert wird.
Inhaltlich ist zu sagen, dass der mit Abstand am häufigsten genannte Autor Philo von Alexandrien ist (mit über 5 Seiten im Register), gefolgt von Plutarch (etwas über 2 Seiten) und Josephus (knapp 2 Seiten). Insgesamt nennt das Register 159 verschiedene Autoren oder Schriften, wobei viele nur mit einem oder zwei Einträgen vorkommen. Der Zeitraum, den die genannten Autoren abdecken, lässt sich leider ohne aufwändige Recherchen nicht überblicken, weil chronologische Angaben fehlen. Die Belege folgen dem Ablauf des MtEv, wobei das gebotene Material sehr unterschiedlich verteilt ist. Das zeigt die Seitenzahl, die jeweils pro Kapitel aufgewandt wird: Sie schwankt zwischen 19 Seiten (Mt 20) und 150 Seiten (Mt 27): Mt 11 (1–48); 12 (49–85); 13 (86–145); 14 (146–180); 15 (181–213); 16 (214–253); 17 (254–273); 18 (274–303); 19 (304–340); 20 (341–359); 21 (360–375); 22 (376–446); 23 (447–543); 24 (544–645); 25 (646–704); 26 (705–843); 27 (844–993); 28 (994–1033). Das liegt natürlich daran, dass die Kapitel unterschiedlich lang sind und bei Mk-Stoff vielfach auf den Mk-Band verwiesen wird, aber es überrascht an manchen Stellen schon, dass hier nicht mehr Material geboten wird. Grundsätzlich gilt, dass es dem Nutzer überlassen bleibt, den Zusammenhang zwischen der Mt-Stelle und dem Zitat herzustellen. Das ist in manchen Fällen offensichtlich, in anderen hat er sich mir nicht erschlossen. Die Mehrheit der Belege gehört m. E. in die Kategorie „nice to know“, ohne dass dadurch der Sinn des biblischen Textes entscheidend erhellt oder verändert würde. Sie zeigen eher, dass bestimmte sprachliche Wendungen oder kulturelle und religiöse Vorstellungen nichts Besonderes, sondern in der Mit- und Umwelt der neutestamentlichen Autoren vertraut und verbreitet waren. Die Ordnung innerhalb der Belegreihen wird ebenfalls nicht erklärt, dazu muss man auf Band II/1, S. XVI–XVII, zurückgreifen. Demnach kommen zuerst die Belege aus dem hellenistischen Judentum, danach „die aus der paganen Gräzität“ und am Ende lateinische Texte. Innerhalb dieser Gruppen soll dann nach Möglichkeit chronologisch geordnet werden. Der deutsche Text ist fast überall vorhandenen Übersetzungen entnommen und nur wo dies nicht möglich war (z. B. für manche Texte von Aelius Aristeides, Plutarch, aber auch für Josephus, Antiquitates [offenbar wurde – und mit Recht – die Übersetzung von H. Clementz von 1899 nicht mehr als hinreichend angesehen]), wurden die Stellen von den Bearbeitern neu übersetzt (insgesamt allerdings eine recht geringe Zahl). Dennoch wird weiterhin eine Reihe von Übersetzungen aus dem 19. Jahrhundert verwendet, die in ihrem Duktus nur schwer zu ertragen sind. Dazu gehört die Übersetzung Lukians von 1827–1832 durch C. M. Wieland (ein besonders abstoßendes Beispiel auf 262). Die Quellentexte sind zumeist kürzer als eine Seite, es gibt aber auch ein paar deutlich längere. Der längste Text umfasst 7 Seiten (Philo, 190–196, zu Mt 15,4). Die wichtigsten Passagen oder Begriffe sind auf Griechisch oder Lateinisch in den deutschen Text integriert, was sehr hilfreich ist.
Sucht man Texte zu einem bestimmten Stichwort, dann bietet sich das Stichwortregister als Einstieg an. Es lohnt sich, es erst einmal ganz zu überfliegen, weil Zusammenhängendes unter mehreren Einträgen zu stehen kommen kann. So gibt es beispielsweise Einträge zu den Stichworten „Beerdigung“, „Begräbnis“ und „Bestattung“ – wer also etwas über Bestattungssitten erfahren will, muss alle drei Einträge durchsehen, dazu noch „Grab“ und „Grabmal“. Auch „Auferstehung“ und „Auferweckung“ werden unterschieden, in beiden Fällen ist die Zahl der Belege sehr begrenzt. Neben „Gebet“ gibt es zusätzlich „beten“, neben „Dirne“ auch noch „Prostituierte“, neben „Geißelung“ auch noch „Auspeitschung.“ Die Liste ließe sich verlängern. Pharisäer gibt es keine (zumindest nicht im Stichwortregister), ebenso fehlen die Sadduzäer; dafür gibt es viele Priester und Hohepriester, aber keine Schriftgelehrten, ebenso enttäuschend ist der Eintrag zu „Älteste“ und Hoher Rat, Ratsversammlung, Sanhedrin – das fehlt alles. „Sikarier“ und „Zeloten“ kommen je einmal vor, dazu viele „Räuber.“ Verlassen kann man sich auf das Register allerdings nicht, denn zu den Dämonen, zu denen es wirklich spannende Texte gibt (z. B. 58–60) taucht gerade die genannte Stelle im Register gar nicht auf (ebenso fehlt der hilfreiche Beleg 261f.).
Im Aufbau folgt der Text dem Matthäustext. Der jeweilige Vers, Versteil oder einzelne Wörter werden auf griechisch zitiert, dann folgen die Quellenbelege. Zwischenüberschriften fehlen bis auf wenige Ausnahmen ganz. Im ersten Band gab es unter solchen Überschriften eine Reihe von exkursartigen Zusammenstellungen, die auch intern noch einmal gegliedert sein konnten. Im vorliegenden Band gibt es das ebenfalls, es sind aber deutlich weniger als im ersten Teil und inhaltlich eher enttäuschend (das Folgende sind die Überschriften, wie sie im Band stehen):
- Die folgenden Texte berühren sich mit obigem Text [gemeint ist Mt 13,18–19] darin, dass die Mitteilung von Worten bzw. Lehre mit dem Ausstreuen von Samen verglichen werden (115f.; es handelt sich um 3 kurze Texte und einen Verweis; wozu es diese Überschrift brauchte, ist mir nicht klar)
- Rein/Unrein (181, zu Mt 15,1–20, es folgen dann aber nur zwei Verweise)
- Tempelsteuer und „Fiscus Judaicus“ (266–271 zu Mt 17,24)
- Zur Bewertung von „Kindsein“ und „Kindlichkeit“ (275–280 zu Mt 18,4)
- Der vornehme Gastgeber erscheint verspätet bei Tisch (397f.– zu Mt 22,11: wozu es dafür eine eigene Überschrift braucht, wenn nur zwei kurze Belege zur Sache kommen, ist unklar; die meisten Texte ab S. 376 zu Mt 22,1–13 beziehen sich auf Gastmähler und da hätten sich andere Sortierungen angeboten; insgesamt ist es aber eine schöne Auswahl für römischen Tafelluxus (auch wenn darauf nicht das Interesse des Gleichnisses liegt; für das fehlende Festgewand des Gastes in Mt 22,11 gibt es dagegen keinen passenden Beleg)
- Wehklage als rhetorisches Mittel (515f., erneut nur 2 Belege zu Mt 23,33–39)
Interessant ist es auch zu sehen, zu welchen Aussagen nur solche aus dem frühjüdischen Bereich angegeben werden – hier zeigt sich die Besonderheit jüdischen Glaubens und Lebens am besten. Allerdings kann man durch die Anlage des NW leider nie genau wissen, ob es keine analogen Aussagen in der griechisch-römischen Literatur gibt, oder ob nur keine ausgewählt wurden, weil eben die Auswahl und Begründung der Textauswahl das Geheimnis der Bearbeiter bleibt. Diese Unsicherheit bleibt auch in die andere Richtung: zu Mt 21,41 werden vier Stellen geboten, in denen die Wendung κακοὺς κακῶς vorkommt: zweimal Sophokles, eine aus Aristophanes, d.h. aus dem klassischen griechischen Theater des 5. Jh. v. Chr., dazu noch ein Beleg von Lukian von Samosata aus dem 2. Jh. n. Chr. Die Parallelen werden offenbar diesem griechischen Syntagma wegen angeführt, da es sonst keine inhaltlichen Parallelen gibt. Die dargebotenen Stellen könnten zu der Annahme verführen, dass Matthäus mit der Sprache der griechischen Theaterschriftsteller vertraut war; immerhin fehlt diese Wendung in der LXX und bei Philo (was aber nicht im NW steht: immerhin regt er an, selbst nachzusehen); sie ist aber mindestens 3-mal bei Josephus (Ant 2.300; 7.291 u. 12.256) bezeugt. Warum keine der drei hier vorkommt? Das wissen allein die Bearbeiter. Was also kann am Ende aus diesen Parallelen gewonnen werden? Die betreffende Wendung kommt bei den genannten griechischen Autoren vor – aber ob regelmäßig, ob wirklich vorwiegend in Bühnentexten, ob auch bei anderen Autoren: nichts! Es gibt zudem regelrechte Enttäuschungen, etwa zu Mt 27,24 (Herodes wäscht seine Hände in Unschuld). Da wird ein Text von Euripides angeführt, wo zwei Menschen, die „nach Notwendigkeit gemäß dem Gesetz“ getötet werden sollen, mit Wasser gereinigt werden! – kein Wort, dass der, der das Urteil spricht, sich einem Reinigungsritus unterzieht (877). Gibt es zu diesem Text wirklich keine echte Parallele in der durchsuchten Literatur? Zu dem notorisch schwierigen Vers 27,25 werden immerhin drei Texte geboten, die eine solche kollektive Verantwortungsübernahme in der griechischen Welt bezeugen (wobei die erste Quellenangabe „Andoc Myst 98“, wahrscheinlich nicht nur mich zum Suchen bringt: es geht um den athen. Rhetor Andokides, der um 440 geboren wurde, und seine Rede De mysteriis; hat man das herausgefunden und nachgeschlagen, um was es in der Rede geht, bekommt man Lust sie zu lesen… – das ist das Schöne an diesen Bänden: sie verführen einen zur eigenen Lektüre!). Man könnte so fast Seite für Seite kommentieren und würde beständig zwischen Ironie, Verwunderung, Begeisterung, Neugier und Stirnrunzeln schwanken.
Martin Hengel schrieb 2003 über diese Methodik: „Die Zusammenstellung von Zitaten zu neutestamentlichen Stellen im Stile des alten Wettstein und des ‚Corpus Hellenisticum‘ reicht – trotz aller Nützlichkeit dieser Werke – nicht mehr aus.“ (M. Hengel, Kleine Schriften VII, Tübingen 2010, 288). Denn Hengel sah deutlich, dass angesichts der Anfänge elektronischer Suchmöglichkeiten in antiken Quellen (konkret: die ersten Versionen des TLG), eine „Überfülle“ von „sprachliche[n] Parallelen“ erreicht werden kann, „ohne die Kontexte wirklich gelesen und verstanden zu haben.“ Darin sah er, neben der „Überfülle der Sekundärliteratur“, die zweite große Gefährdung der theologischen Existenz (KS VII 287). Angesichts von KI-gestützter big data-Forschung ist diese Herausforderung noch viel größer geworden. Umfangreiche und eigenständige Quellenlektüre lässt sich aber, wenn es um das eigene Verstehen geht, nicht delegieren. Es geht darum, mit solchen Auszügen, wie sie der NW bietet, nicht zufrieden zu sein, sondern sich durch sie verführen zu lassen, nun eben doch den Auszug in seinem Kontext zu lesen.
Am Ende bleibt als Fazit, was in ähnlicher Weise über alle Bände des NW gesagt werden kann: Es ist eine faszinierende Wundertüte, die Spannendes, Kurioses, Interessantes, Wichtiges und Unwichtiges in bunter Mischung bringt. Er macht Lust auf diese Texte, und das ist kein kleines Verdienst. Dass die Herausgeber einem die Arbeit mit diesen Texten nicht abnehmen, ist möglicherweise ein pädagogisches Konzept (immerhin weiß ich jetzt, wer Andokides ist), das erst enthüllt wird, wenn einmal auch noch die Bände zum lukanischen Doppelwerk vorliegen werden. Und vielleicht wird dann ja der Wunsch des Rezensenten nach einer vollständigen Autoren-, Quellen- und Abkürzungsübersicht erfüllt.
Prof. Dr. Roland Deines, Prorektor und Professor für Biblische Theologie und Antikes Judentum an der Internationalen Hochschule Liebenzell