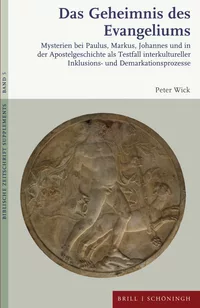Peter Wick: Das Geheimnis des Evangeliums
Peter Wick: Das Geheimnis des Evangeliums. Mysterien bei Paulus, Markus, Johannes und in der Apostelgeschichte als Testfall interkultureller Inklusions- und Demarkationsprozesse,Biblische Zeitschrift Supplements 5, Paderborn: Brill Schöningh, 2023, geb., 479 S., € 129,−, ISBN: 978-3-506-79634-9
Peter Wick ist Inhaber des Lehrstuhls für Exegese und Theologie des Neuen Testaments an der Ruhr-Universität Bochum. In seinem Buch geht er der komplexen Frage nach, in welcher Weise in den neutestamentlichen Schriften Motive und Inhalte aus der Welt der Mysterienkulte aufgenommen wurden bzw. wie sie sich von ihnen abgrenzten. Er verwendet insbesondere die griechische Form Mysterion, „um auf das Unauslotbare hinzuweisen, das in diesem Begriff mitschwingen kann. Das Mysterion ist unter dieser Perspektive der Schlüssel zum Leben an sich, ja es ist der Zyklus des Lebens“ (3). Die differenzierte Aufgabenstellung erläutert Wick im ersten einleitenden Kapitel (1-10).
Im 2. Kapitel stellt Wick die „Perspektiven der Geheimnis- und Mysterienforschung“ dar (11-34). Er sieht die Geheimnis-Forschung als ein „vermintes Forschungsfeld“ an, zum einen, weil die Forschung oft von bestimmten (auch konfessionellen) Interessen mitbestimmt wurde, zum anderen, weil die Bedeutung des Begriffs Mysterion umstritten ist, ebenso das Geheimnis und die Bedeutung der antiken Mysterien.
Das 3. Kapitel ist das längste und gibt einen Überblick über die antiken Mysterienkulte (35-151). Als Mysterien werden verschiedene Kulte bezeichnet, „in denen die Geheimhaltung eine zentrale Rolle spielt“ (35). Sie sind geheime Formen eines Kults, der auch als öffentlicher Kult verbreitet war. Ziel der Mysterien ist „nicht die Erlösung, sondern die qualitative Verbesserung des diesseitigen Lebens“ (39); sie versprechen zugleich eine Verbesserung der Existenz nach dem Tod. Wick nennt drei Typen von Trägern der Mysterien: den wandernden Charismatiker, eine Priesterschaft und den Kultverein. – Als erstes werden die Mysterien von Eleusis (Demeter/Ceres – Kore/Persephone) ausführlich dargestellt, da „die eleusinischen Mysterien Vorbild für alle anderen Mysterien waren“ (47). Im Mittelpunkt des Kapitels stehen jedoch die Mysterien des Dionysos (67-107). Er war kultisch am weitesten verbreitet. Er ist der vielgestaltige Gott, der viele Namen hat und viele Epiphanieformen besitzt, ein Gott des Wandels (81). „Er ist der Gott, der die Feier des Lebens mit Wein, Freude, Fruchtbarkeit, Sexualität und Ekstase repräsentiert“ (107). Abschließend stellt Wick Mysterien dar, die auch als „orientalische Kulte“ bezeichnet werden, weil sie sich auf orientalische Traditionen beriefen; doch waren sie als Mysterien hellenistisch geprägt: die Mysterien der Kybele und des Attis (110-114), von Isis, Osiris und Serapis (115-136) sowie des Mithras (136-140). – Am Schluss des Kapitels fasst Wick seine Ergebnisse zum Sinnpotential und den Funktionen der Mysterien übersichtlich zusammen (142-150). Als zentralen Teil des Geheimnisses nennt er „die Erfahrung des heilvollen Wandels“ (149). Das „unauslotbare Geheimnis“ kann adäquat nicht durch Worte vermittelt werden, sondern muss erfahren werden. „In solch einer rituellen Erfahrung wird das eigene Leben miterlebt“ (149). In der Schau als dem Höchsten wird das Geheimnis geschaut und erfasst, ist aber unauslotbar. Keine Erklärung kann das ganze Sinnpotential erfassen und deuten.
Im 4. Kapitel geht es um „Inklusion von Mysterienelementen im Judentum“ (153-176). Wick kommt zu dem Ergebnis, dass keine jüdische Bewegung zu einem Mysterienkult transformiert wurde, weil die wesentlichen Elemente der Mysterien dem jüdischen Gottesglauben fremd geblieben sind. Wenn in jüdischen Schriften vom Geheimnis die Rede ist, sind es solche, die erwählten Menschen von Gott offenbart werden, nicht unsagbare Geheimnisse. Mysterienkulte sind bekannt; man grenzt sich von ihnen ab, auch wenn sprachlich Symbole und Rituale rezipiert werden können.
Das 5. Kapitel bietet eine kurze Hinführung zum Thema „Das Neue Testament und die Mysterienkulte“ (177-180), bevor in den folgenden Kapiteln Paulus (6. Kap.), das Markusevangelium (7.), Johannes (8.) und die Apostelgeschichte (9.) untersucht werden, und zwar daraufhin, ob bewusst Mysterientradition inkludiert wurde. Dabei kommt es darauf an, dass sich nicht nur einzelne Merkmale finden, sondern eine Kombination von Elementen, die in biblisch-jüdischen Texten nicht inkludiert wurden.
Wick meint im 6. Kapitel (181-261), dass in Röm 6,1-14 Mysterientradition aufgenommen sei. Diese sieht er in der Partizipation am Geschick der Gottheit (Christus), bei der dem Tod eine positive Funktion zukommt. Die Taufe versteht er als initiatorischen Akt, durch den die Partizipation am Tod und Sterben Christi geschieht (192.199). Kritisch einzuwenden ist, dass die Taufe in Röm 6,4 nicht als Sterben mit Christus, sondern als Begräbnis gedeutet wird, was Wick ebenfalls sagt, aber dennoch auch von der Partizipation am Sterben Christi in der Taufe spricht. Als Begräbnis ist die Taufe kaum als Initiationsakt zu verstehen, sondern bestätigt das vorherige Gestorben-Sein mit Christus. Die Anteilhabe am stellvertretenden Tod Christi erfahren die Menschen durch den Glauben und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Vorstellung der Partizipation am Sterben und Auferstehen Christi kann auf Mysterientradition verweisen. – In 1Kor 15,36f verbindet Paulus beim Säen als Bild für das Sterben „den Deutehorizont der jüdischen Weisheit mit dem der antiken Mysterien, die das Sterben als notwendigen Schritt zur Fruchtbarkeit besonders thematisiert haben“ (208). Die biblische Diskontinuität des Leibes verbindet Paulus mit der „Kontinuität zwischen totem Körper und Auferstehungsleib“ aus der Mysterientradition (212). Letzteres geschehe, indem Paulus als Gegenbegriff zu „auferstehen“ den Begriff „säen“ in 15,42-44 verwendet (218.221). Fruchtbarkeitsvorstellungen sehe ich hier nicht, zumal Paulus nicht vom Ernten spricht. Die Formulierung, der Leib werde „zur unverzichtbaren Vorbedingung für den Auferstehungsleib“ (258), erscheint mir überspitzt. Das Geheimnis (μυστήριον) in 15,51f versteht Wick als „ein bleibendes Geheimnis“, das „letztlich unfassbar bleibt und so eleusinischen Traditionen nahekommt“ (226; vgl. 235). Das Geheimnis verstehen nur die Erwählten bzw. Glaubenden. Wick sieht darin zu Recht eine Assoziation zu den Mysterien: „Nur den Vollkommenen, den ganz Eingeweihten ist das Mysterion voll anvertraut. Alle anderen werden es nicht verstehen“ (237). Bei Paulus dient „das Mysterion … der Umschreibung des alles umfassenden Heilsplans Gottes“ (259). Dieser bei Gott verborgene Heilsplan ist in Christus offenbart worden und kann verkündigt werden, ist also sagbar. Das Verständnis des Mysterions als „unauslotbar“ ist so zu verstehen, dass es „einen bleibenden, unauslotbaren Anteil im Geheimnis“ gibt, d. h. es bleibt ein Geheimnis, das die Glaubenden rational nie ganz erfassen, in dessen Erkenntnis sie aber weiter wachsen sollen.
Im 7. Kapitel zu Markus (263-337) geht Wick von Mk 4,10-13 aus; nur hier ist im Evangelium vom Geheimnis die Rede, nämlich vom μυστήριον τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, das den Jüngern gegeben ist, nicht den anderen Zuhörern. Gegenüber Matthäus und Lukas fällt auf, dass diese γνῶναι (erkennen) ergänzen und μυστήριον im Plural steht. Bei Markus verstehen die Jünger nicht nur die Worte, sondern erfahren die Partizipation an Jesus und seinem Weg; sie gelangen zum „Schauen im Sinne der Ein-Sicht, des tiefen Hinein-Sehens in die verborgene Wahrheit der Dinge“ (265). Wick spricht vom „verhüllenden Charakter der Gleichnisse“ (267), doch sagt Mk 4,33 als Abschluss der Gleichnis-Rede, dass Jesus den Menschen durch die Gleichnisse das Wort sagte, wie sie es hören (bzw. verstehen) konnten. Wicks Auslegung der Gleichnisse überzeugt mich nur teilweise, besonders des von der selbstwachsenden Saat und des vom Senfkorn. Der Bezug zu Fruchtbarkeits-Mysterien leuchtet mir hier nicht ein. Nach den Gleichnissen stellt Wick im weiteren Verlauf des Markusevangeliums den „Weg durch Schrecken und Unverständnis zur Schau“ (283-311) dar, der bei mir viele Fragen hinterlassen hat. Zum Verständnis des Markusevangeliums trägt dagegen bei, wie Wick die Probleme des sog. Messiasgeheimnisses beschreibt und deutlich macht, dass es bei Markus um das Geheimnis des Gottesreichs geht. „Das Markusevangelium handelt nicht von einem enträtselbaren Messiasgeheimnis, sondern vom Mysterion des Weges und der Kraft des Wortes beziehungsweise vom Mysterion des Weges und der Kraft von Jesus als dem Messias“ (327).
Wick stellt fest, dass das Hauptreferenzsystem des Johannesevangeliums das Alte Testament und die Vorstellungswelt des Frühjudentums bilden (369). Doch weise das Evangelium viele Parallelen zum Dionysosmythos auf (362). Dabei geht es nicht um „einzelne Anspielungen, sondern um ein ganzes Geflecht von Assoziationsmöglichkeiten“ (367). Dabei spielen das Weinwunder zu Kana (Joh 2,1-11) und die Rede vom Weinstock und den Reben (15,1-8) eine hervorgehobene Rolle. Wick meint, dass „die Rezeption von Mysterienelementen“ helfe, „den eigenen Anliegen mehr Tiefenschärfe zu geben“ (370).
Im 9. Kapitel untersucht Wick „Dionysos-Motive in der Apostelgeschichte“ (373-418). Dazu zählt er den Siegeszug der Jesus-Bewegung in der Fremde, d. h. in der hellenistischen Kultur, sowie das Theomachie-Motiv. „Die Inklusion dieser dionysischen Elemente wird eine kommunikativ-missionarische Funktion gehabt haben“ (394). Der Theomachie-Begriff kommt im NT allerdings nur in Apg 5,39 vor, wo Gamaliel sagt, die jüdische Führung solle sich nicht als gegen Gott kämpfend erweisen; sonst spricht das NT von Verfolgung, Widerstand und Leiden. M.E. begründet auch das Vorkommen der Wendung „wider den Treiberstachel ausschlagen“ in Apg 26,14 und in den Bacchantinnen des Euripides nicht ausreichend die These, dass „das Theomachiemotiv aus dem Dionysosmythos … als narratives Leitmotiv aufgenommen“ werde (418).
Im 10. Kapitel fasst Wick den Ertrag seiner Forschungen zusammen (419-428). In den letzten beiden Kapiteln gibt er kurze Ausblicke zum einen für die Kirche des 2.–5. Jahrhunderts (429-433), zum anderen mit Perspektiven für heute (435-439).
Die Arbeit von Wick leistet einen wichtigen Beitrag für das Verständnis der antiken Mysterienkulte. Schon ihre Darstellung lässt für Leser und Leserinnen viele Parallelen zum christlichen Glauben aufleuchten. Trotz einzelner kritischer Anmerkungen empfehle ich das Buch, auch aufgrund der gründlichen Exegesen und dem Aufzeigen theologischer Zusammenhänge. Wick stellt dar, wie einige neutestamentliche Autoren sich gegenüber Mysterienvorstellungen abgrenzen, während andere Autoren Traditionen auch inkludierten und so die eigene Identität weiterentwickelten – eine spannende Auseinandersetzung.
Dr. Wilfrid Haubeck, Professor em. für Neues Testament und Griechisch an der Theologischen Hochschule Ewersbach in Dietzhölztal