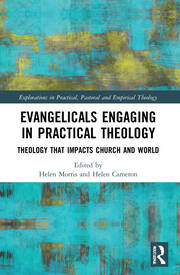Helen Morris / Helen Cameron (Hg.): Evangelicals Engaging in Practical Theology
Helen Morris / Helen Cameron (Hg.): Evangelicals Engaging in Practical Theology. Theology That Impacts Church and World, Explorations in Practical, Pastoral and Empirical Theology, London: Routledge, 2022, Pb., XII+255 S., ca. € 45,–, ISBN 978-0-367-55748-5
Der vorliegende Sammelband bietet Einblicke in die evangelikale Praktische Theologie in Großbritannien (UK) und verfolgt dabei zwei Hauptziele: Zum einen sollen Beispiele praktisch-theologischer Forschung aus evangelikaler und pentekostaler Sicht präsentiert werden, zum anderen geht es darum, methodische wie inhaltliche Kernanliegen herauszuarbeiten, die Evangelikale in den breiteren praktisch-theologischen Diskurs einbringen. Die insgesamt 14 Beiträge des Bandes gliedern sich in fünf Teile: Teil I („Engaging with the discipline“, 23-84) widmet sich dem Wesen und der Methode Praktischer Theologie, in Teil II („Engaging with education“, 85-130) wird die Frage gestellt, wie Praktische Theologie unterrichtet werden kann, Teil III („Engaging with practice“, 131-166) reflektiert anhand zweier Beispiele die Ressourcen evangelikaler Theologie für das christliche Engagement in der Gesellschaft, Teil IV („Engagement by students“, 167-200) enthält Beiträge gegenwärtiger Studenten der Praktischen Theologie zu unterschiedlichen Themenfeldern, bevor Teil V („Theology that impacts church and world“, 201-224) den gegenwärtigen Stand der Praktischen Theologie aus britisch-evangelikaler Perspektive analysiert. Wie in jedem Sammelband unterscheidet sich auch hier die Qualität der Beiträge mitunter deutlich. Und trotz des Versuches der Herausgeberinnen, dem Band einen roten Faden zu verleihen, fällt es aufgrund der Vielfalt der behandelten Themen doch bisweilen schwer, den leitenden Fokus zu erkennen.
Für lesenswert – und auch für den deutschen Diskurs instruktiv – halte ich neben den einleitenden Ausführungen und der abschließenden Zusammenfassung der Herausgeberinnen vor allem die beiden Aufsätze von Andrew Thomas („Practical Theology and Evangelicalism: Methodological Considerations“, 24-39) und Mark J. Cartledge („Evangelical Practical Theology: Reviewing the Past, Analysing the Present and Anticipating the Future“, 203-217). Anhand des bekannten „Bebbington-Quadrilaterals“ als Beschreibung evangelikaler Grundüberzeugungen (1. ein Bibelverständnis, das von der göttlichen Inspiration und der Autorität der Bibel ausgeht, 2. die Zentralität des Opfertodes Christi am Kreuz, 3. die Notwendigkeit einer persönlichen Bekehrung und 4. das missionarische und soziale Handeln) arbeitet Thomas im Sinne einer methodischen Offenlegung distinkte Aspekte einer evangelikal geprägten Praktischen Theologie heraus. Dabei wird augenfällig, dass aus evangelikaler Sicht weiterhin die weichenstellende Frage im Raum steht, wie innerhalb einer zunehmend wahrnehmungs- und erfahrungsorientierten akademischen Praktischen Theologie mit theologischen Quellen umgegangen werden soll. In diesem Zusammenhang bemängelt Cartledge im Kontext evangelikaler Praktischer Theologie eine häufig recht oberflächliche Verwendung biblischer Texte im Sinne einer linearen „angewandten Theologie“, bei der biblische Aussagen in direkter Weise zur zeitgenössischen Praxis führen. Dieser, der Autorität der Bibel verpflichtete, aber hermeneutisch kurzschlüssige „proof-text approach“ habe in der Vergangenheit stellenweise zu einer „sectarian attitude to the wider academy“ und somit zu einem Gesprächsabbruch mit anderen theologischen Traditionen geführt (207). Andererseits weist Cartledge zurecht darauf hin, dass die starke Betonung empirischer Praxisforschung große Einseitigkeiten innerhalb der Disziplin befördere und es sich stellenweise anfühle „like ‘theologyʼ has been left behind or reduced to a descriptive element rather than a constructive one.” (208) Vor diesem Hintergrund plädiert er im Anschluss an die Entwürfe von Andrew Root und Pete Ward für eine Praktische Theologie, die sowohl die vorfindliche Praxis als auch die Heilige Schrift als normative theologische Quelle ernst nimmt. Damit sei eben nicht gesagt, dass die praktisch-theologische Arbeit zwingend mit der Schrift beginnen müsse: „The idea that we should start with Scripture suggests that if we do not then we are somehow not giving it the due weight it deserves, and this is the point. It is not really a question of chronology but rather of weight.” (209) Insofern sei die Disziplin der Praktischen Theologie als gleichsam empirisch-wahrnehmungsorientierte und handlungsorientierte Theorie zwischen Praxis und Praxis zu entwerfen, die sich hermeneutisch durchdacht über ihre biblisch-normative Grundorientierung Rechenschaft zu geben habe. Für die zukünftige Weiterentwicklung einer evangelikalen Praktischen Theologie wäre dann u. a. entscheidend, die vorhandenen Grenzen zu anderen theologischen Subdisziplinen wie den Bibelwissenschaften und der Systematischen Theologie bewusster zu überwinden und eingehender über das Verhältnis der Praktischen Theologie zur Empirie zu reflektieren. Im besten Fall entstünde so eine solide Grundlage, um den „empirical turn“ innerhalb der Praktischen Theologie ohne theologische Substanzverluste begründet und mit Augenmaß mitzuvollziehen. Im Sinne einer realistischen Wahrnehmung der methodisch immer vorausliegenden Praxis ginge es darum, „to embrace empirical research with a bit more enthusiasm“ (211). Das alles mit dem Ziel, zu einer ausgewogenen Praktischen Theologie beizutragen, „that seeks to capture something of the life of the church, offer critical reflection on its life, and then suggest constructive ways forward.“ (213)
In seinen thematischen Einzelheiten erscheint der von Morris und Cameron herausgegebene Band für den deutschen Diskurs nur begrenzt hilfreich. Dennoch erweist sich – ungeachtet des politischen Brexits – der Blick auf die Insel vor allem dort als anregend, wo in den Teilen I und V über die Wesensbestimmung und Methode einer Praktischen Theologie evangelikaler Provenienz reflektiert wird. Denn die dabei aufgeworfenen Fragen sind der „evangelical community“ auch hierzulande als Aufgabe gestellt. Die von den britischen Kolleginnen und Kollegen angedeuteten Antworten und Zukunftsperspektiven könnten dabei helfen, sich des eigenen evangelikalen Profils zu vergewissern und dieses in Auseinandersetzung mit anderen theologischen Standpunkten und praktisch-theologischen Entwürfen konstruktiv und differenziert weiterzuentwickeln.
Prof. Dr. Philipp Bartholomä, Professor für Praktische Theologie an der FTH Gießen