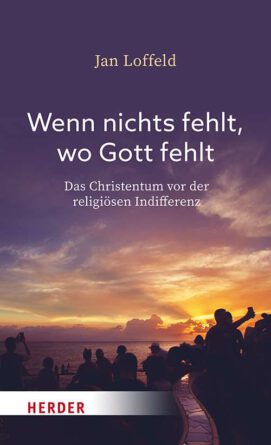Jan Loffeld: Wenn nicht fehlt, wo Gott fehlt
Jan Loffeld: Wenn nicht fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz, Freiburg im Breisgau: Herder, 2024, geb., 192 S., € 22,–, ISBN 978-3-451-39569-7
Der Utrechter Praktische Theologe Jan Loffeld hat ein Buch mit einem Titel, der aufhorchen lässt, verfasst. Loffelds These lautet, dass „vielfältige und in sich sehr komplexe Indifferenz- bzw. Säkularitätsphänomene eine der größten Herausforderungen für das Christentum des 21. Jahrhunderts“ (18) seien.
Er stimmt mit dem Religionssoziologen Detlef Pollack in der Analyse der sechsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU VI) überein, dass die in der jüngeren Vergangenheit vielfach vertretene Individualisierungsthese dem empirischen Befund nicht hinreichend gerecht wird. Zwar gebe es unbestreitbar Religiosität außerhalb klassischer kirchlicher Mitgliedschaft, dennoch sei diese mit nur 6 % marginal. Viel präsenter wahrzunehmen sei eine Bewegung, die hin zu einer „Gleichgültigkeit in religiösen Fragen“ (9) führe (Stichwort: „säkulares Driften“). Teilweise nimmt der Autor auch einen weitergehenden Trend von Indifferenz hin zu einer „völlige[n], abweisende[n] Geschlossenheit gegenüber allem Religiösen“ (38) wahr, die auch als Religionsfeindlichkeit charakterisiert werden könne.
Loffeld hat sein Buch in fünf Teile gegliedert, die unabhängig voneinander zu lesen sind. Im ersten Teil analysiert der Vf. zwei gegenwärtige Lesarten, die er als Optimierungsparadigma einerseits und Transformationsparadigma andererseits bezeichnet. Die der Individualisierungsthese zugeschriebene Annahme „Dort, wo Kirche gut ist, lässt sich Entkirchlichung bzw. Säkularisierung stoppen“ sei dem Vf. zufolge relativiert worden. Vielmehr müsse konstatiert werden, dass ein kontinuierlicher Relevanzverlust des christlichen Glaubens sichtbar sei. Loffeld plädiert selbst für ein Transformationsdenken, bei dem „Optimierung bzw. Reform einerseits absolut notwendig sind, allerdings nicht hinreichend.“ (24) Präzise beschreibt Loffeld den Zustand der religiösen Indifferenz als „Null-Ort, ein Ort, an dem nichts ist und nichts sein soll.“ (45)
Der zweite Teil reflektiert pastoraltheologische Beobachtungen und resümiert, dass Säkularisierung zwar einen „Megatrend, aber kein[en] Universaltrend“ darstelle. Demnach werden Religion und Glaube nicht gänzlich verschwinden.
Im dritten Teil sucht der Vf. nach Gründen für diesen Relevanzverlust. Er bemerkt außerdem, dass die empirische Forschung hinsichtlich des „Zum-Glauben-Kommens“ noch zu wenig wisse. An dieser Stelle hätte der Blick über den konfessionellen Tellerrand zur Greifswalder Konversionsstudie (2010) sich als hilfreich erweisen können. Einen christlichen Universalismus deutet der Vf. weiter und sieht in Konversion und Mitgliedschaft „kein[en] Zweck an sich, sondern funktional der Präsenz des Evangeliums als lebendiger Option untergeordnet.“ (107)
Im vierten Teil zeigt der Vf. unterschiedliche Perspektiven eines Christentums in der Transformation auf: eine Kultur der Exnovation, ein bewusstes Aushalten der Leere (Karsamstag), ein neues Suchen Gottes und die Erwartung, dass er auch im säkularen Kontext sichtbar und erfahrbar wird. Ebenso fragt der Vf., inwieweit die Bilder der (katholischen) Kirche einer stärkeren kenotischen und damit postkonstantinischen Dimension bedürfen: seiner selbst bewusst und zugleich dienend und demütig.
Versöhnlich beschließt Loffeld sein Fazit, dass Gott auch heute als befreiend, rettend und heilend erfahren wird und deshalb Christus die Hoffnung sei.
Dem selbst gegebenen Ziel, „die eigene pastorale Praxis neu zu bedenken“ und eine „Gesprächseröffnung“ zu liefern, wird das vorliegende Buch mehr als gerecht. Loffeld adressiert das Buch an geneigte Leserinnen und Leser in der Gemeindepraxis und formuliert allgemeinverständlich und stringent.
Ein engagiertes, flüssig lesbares Buch, das den Finger in die Wunde legt, messerscharfe Anamnese betreibt und mögliche Behandlungen für den Patient „Kirche“ vorsichtig durchdenkt. Ein Buch zum Diskutieren und Weiterdenken.
Andreas Schmierer, Pfarrer der Württ. Landeskirche und Studienassistent im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen