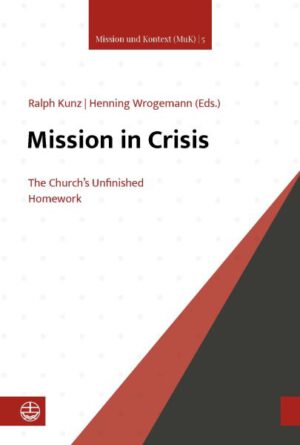Ralph Kunz / Henning Wrogemann (Hg.): Mission in Crisis
Ralph Kunz / Henning Wrogemann (Hg.): Mission in Crisis. The Church’s Unfinished Homework, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2024, Pb., 228 S., € 48,–, ISBN-13 978-3374075775
Der Sammelband „Mission in Crisis: The Church’s Unfinished Homework”, herausgegeben von den Professoren Ralph Kunz (Praktische Theologie, Universität Zürich) und Henning Wrogemann (Religionswissenschaft und Interkulturelle Theologie, Kirchliche Hochschule Wuppertal), enthält die Beiträge einer Tagung, die 2022 unter dem gleichnamigen Titel in Zürich stattfand. In diesen beschäftigen sich protestantische Praktische Theologen und Missionswissenschaftler aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, den Niederlanden und England mit der Frage, inwiefern die christliche Mission in Westeuropa gegenwärtig in einer Krise steckt und wie mögliche Wege aus dieser Krise aussehen könnten. Das Buch ist in die zwei Abschnitte „Limits and Chances of Church Mission in the German-Speaking World“ und „Mission in Crisis – A Global Phenomenon? Contextual Perspectives” eingeteilt.
Im einleitenden Kapitel diskutiert Kunz (17-42) die innerhalb der Landeskirchen so häufig verbreitete Aversion gegenüber dem Thema Mission und die Zukunft des Konzepts Volkskirche angesichts dessen. Müller (43-56) plädiert dafür, dem Thema Jüngerschaft im deutschen praktisch-theologischen Diskurs mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Diese versteht sie als die hoffnungsspendende Interpretation des eigenen Lebens durch Erfahrungen von Transzendenz im Alltag. Ihr Anliegen ist zu würdigen, jedoch bleibt die normative Komponente der Schrift unterreflektiert. Nach Mt 28,19-20 hängt Jüngerschaft ganz wesentlich mit dem Unterweisen in der Lehre Jesu zusammen. Diese muss die ultimative hermeneutische Brille sein, durch die das eigene Leben mitsamt seinen transzendenten Erfahrungen gedeutet wird.
Bartholomä (57-82) und Todjeras (83-93) fragen dann nach Impulsen für die frei- und landeskirchliche Missionsarbeit in einem post-christlichen Kontext. Während Bartholomä sich dabei an russlanddeutschen Freikirchen orientiert, greift Todjeras Anregungen aus der „post-evangelikalen“ Szene auf. Meiner Meinung nach wären auch die Beiträge von Wrogemann (165-179) und Schweyer (193-208) besser im ersten Buchabschnitt verortet gewesen. Ersterer reflektiert, wie angesichts sinkender Mitgliedszahlen die Lebendigkeit von Kirche gedacht werden könnte und letzterer analysiert die drei Sozialformen der Kirche nach Hauschildt und Pohl-Patalong (Institution, Organisation, Bewegung) hinsichtlich ihrer Missionskompatibilität.
Im zweiten Teil, der ergänzende Perspektiven auf die Thematik enthält, heben Tomlin (97-114), van den Toren (149-163) und Breitenstein (209-224) allesamt die Wichtigkeit einer Wiederentdeckung von Apologetik für Mission im spätmodernen Europa hervor. Nach Tomlin und Breitenstein geht es dabei allerdings nicht um die rationale Verteidigung des christlichen Glaubens, sondern um eine erneuerte Vision des Lebens in dieser Welt im Lichte der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, in dem alle existenziellen Sehnsüchte des Menschen erfüllt werden. Unnötigerweise sind diese drei ähnlichen Aufsätze jedoch über die Kapitel fünf, acht und zwölf verteilt, was ein gemeinsames Lesen erschwert.
Das gemeinsame Thema des Sammelbandes, die Krise der Mission, wird in den einzelnen Beiträgen durchaus unterschiedlich interpretiert. Während manche diese vor allem im Sinne sinkender Kirchenmitgliedschaftszahlen und mangelnder missionarischer Erfolge deuten, weisen andere in alternative Richtungen. Paas zufolge bestünde die Missionskrise primär darin, dass die meisten Christen in Europa das praktische Vertrauen in das Evangelium verloren hätten und dadurch nicht davon berichten können, wie es Personen und Gesellschaften transformieren kann (117). Nach Kunz sollte man eigentlich gar nicht von einer Krise der Mission sprechen, weil es in Wirklichkeit die Mission Gottes ist, die die Kirche immer in die Krise stellt (23). Und auch Flett (131-148) bemängelt ähnlich, dass die Rede von einer Missionskrise oft nur gebraucht wird, um zu vermehrtem missionarischem Handeln zu motivieren. Dies widerspräche aber fundamental der missionstheologischen Einsicht, dass Kirche ihrem Wesen nach, also auch im „Normalbetrieb“, missionarisch sein muss.
„Mission in Crisis“ bietet unterschiedliche Perspektiven auf die aktuelle Lage und Zukunft der protestantischen Kirchen in Westeuropa. Die Beiträge geben wertvolle Gedankenanstöße hinsichtlich der Frage, wie diese auch angesichts sinkender Mitgliedschaftszahlen und schwindendem gesellschaftlichen Einfluss treu an der Mission Gottes teilnehmen können.
Thomas Kräuter, M.A. B.A., PhD-Student an der ETF Leuven und freikirchlicher Pastor in Wien