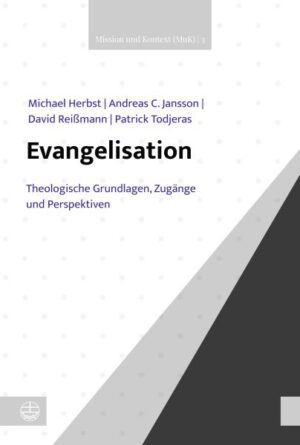Michael Herbst u. a. (Hg.): Evangelisation
Michael Herbst u. a. (Hg.): Evangelisation. Theologische Grundlagen, Zugänge und Perspektiven, Mission und Kontext (MuK) 3, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2024, geb., 540 S., € 39,–, ISBN 9783374075140
Eine naheliegende Assoziation zum Begriff Evangelisation im universitären Kontext ist das (aus Greifswald inzwischen weggezogene) Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung, mithin eine handlungstheoretische Form sowie eine neupietistisch / evangelikale Konnotation von Praktischer Theologie. Das von dort stammende Autorenquartett Michael Herbst, Andreas C. Jansson, David Reißmann und Patrick Todjeras legt ein Standardwerk vor, das geeignet ist, Evangelisation aus derartigen Schubladen herauszuholen und als einen Zentralbegriff in der Weite evangelischer Theologie zu etablieren. Es bietet zehn Beiträge von jeweils einem der Autoren, die in den drei Teilen „Zugänge“, „Theologische Grundlagen“ und „Perspektiven“ locker zusammengefügt und jeweils mit zusammenfassenden Thesen versehen sind.
Mittels exegetischer und kirchengeschichtlicher Analysen wird die Begriffsentwicklung mit bis heute nachwirkenden Weichenstellungen tiefgründig nachgezeichnet. So ging aus dem biblischen basar (hebräisch) bzw. euangelizomai (griechisch) das nichtbiblische Substantiv Evangelisation hervor, das ohne direkte philologische Entsprechung in der Gegenwart primär mit dem „Missionsbefehl“ aus Mt 28 verknüpft ist. Im Aufstieg der äußeren Mission war Evangelisation organisch mit Diakonie verwoben, ohne allein auf Erweckungsbewegung oder Pietismus festgelegt zu sein. Während der Missionsbegriff heute zumindest teilweise rehabilitiert und theologischer Allgemeinbegriff zu sein scheint, bleibt Evangelisation im deutschsprachigen Raum weitgehend an den Raum der Missionswissenschaft gebunden und wird problematischer Tendenzen wie beispielsweise der Übergriffigkeit gegenüber zu evangelisierenden „Objekten“ verdächtigt.
Todjeras versucht um theologischer Weitung willen, Evangelisation als Bestandteil lutherischer systematischer Theologie zu beschreiben. Eine kindertaufende Kirche bleibe in der Verpflichtung, aktiv zum Glauben zu rufen. Gottes Auftrag zur Evangelisation bestehe neben der Tatsache, dass er allein Glauben in Menschen unfreien Willens weckt. Dabei müsse individuell kein bestimmter Zeitpunkt der Glaubensaneignung feststellbar sein.
Jansson bestimmt verbale, intentionale und christuszentrierte Evangelisation als Facette der missio Dei. Evangelisation müsse sich mit diesem Profil missionswissenschaftlicher bzw. praktisch-theologischer Kritik stellen, wobei zwischen menschlich vermeidbarem Ärgernis und unvermeidlichem Skandalon des Evangeliums zu unterscheiden sei.
Herbst trägt eine ausführliche „Praktische Theologie der Evangelisation“ bei, die sich auch als kritische Bilanz jahrzehntelanger Reflexion lesen lässt. Er beschreibt Evangelisation als langen, steinigen Weg von Gemeinden, der ohne ideologische oder methodische Engführungen in einem kulturell-gesellschaftlich schwierigen Umfeld zu begehen sei.
Reißmann bietet abschließend Rekontextualisierungen des Evangelisationsbegriffs. Statt der primären Anbindung an den Sendungsauftrag aus Mt 28 soll er seine Herleitung zuvorderst aus der Sendungsoffenbarung des Freudenboten aus Jes 61 und deren Zitierung in Lk 4 erhalten. Gegenüber einem von der Entleerung bedrohten Eigennamen „Evangelisation“ bevorzugt er die wörtliche Übersetzung „Frohbotschaften“, wobei die Verbindung des Affekts Freude aufgrund der Präsenz Christi mit der Botschaft des facettenreichen, aber bestimmbaren Evangeliums konstitutiv sei. Die frohbotschaftende Kirche wende sich aus ihrer gesellschaftlichen Partikularität heraus kommunizierend an ihre Gegenüber. Sie folge nicht einem problematischen Axiom allgemeiner Religion, das dem einzigartigen Profil des Evangeliums letztlich nicht gerecht werde.
Insgesamt vermögen die verschiedenartigen Beiträge des Bandes der Theologie (und auch der kirchlichen Praxis?) einen nahezu unter Quarantäne stehenden Begriff neu darzubieten und ihr damit einen Energieschub zu geben, ist die Freude an der Botschaft des Gekreuzigten und Auferstandenen doch eine Urkraft der christlichen Kirche. Die Diskurse um Evangelisation bedürfen entschiedener Weiterführungen, wie sich im vorliegenden Werk unter anderem an den immerhin vorhandenen, aber im Anfangsstadium befindlichen Überlegungen zur Digitalität oder an den wenig ausgemalten Abgründen menschlicher Existenz, denen sich Evangelisation stellt, deutlich wird.
Dr. Johannes Schütt, Klinikseelsorger, Leipzig