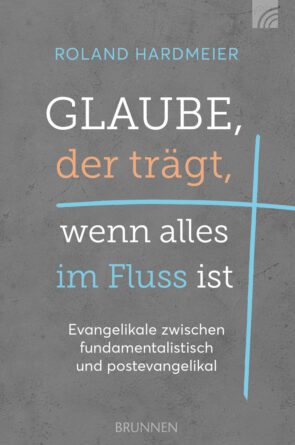Roland Hardmeier: Glaube, der trägt, wenn alles im Fluss ist
Roland Hardmeier: Glaube, der trägt, wenn alles im Fluss ist. Evangelikale zwischen fundamentalistisch und postevangelikal, Gießen: Brunnen, 2024, 330 S., Pb., € 25,–, ISBN 978-3-7655-2189-8
Die westliche evangelikale Welt wird zunehmend erschüttert. Wo es vor 50 Jahren noch gemeinsame Bekenntnistexte und Grundlagen gab, brechen diese heute zunehmend weg. In den wesentlichen Glaubensfragen war sich die evangelikale Welt einig. Verstärkt werden zentrale Glaubensdogmen und eine strikt an der Bibel orientierte Ethik abgelehnt oder zumindest infrage gestellt. Zwei Wege führen aus diesem Dilemma: Die Fundamentalisten ziehen sich aus der öffentlichen Debatte zurück und verteidigen ihr traditionelles Weltbild, die Postevangelikalen gehen mit der Gesellschaft und finden mithilfe der universitären Bibelwissenschaft zu neuen Denkmustern.
Das neue Buch des Schweizer Missionstheologen Roland Hardmeier (geb. 1965) bewegt sich zwischen diesen Polarisierungen und will vermitteln. In seinem Buch Glaube, der trägt, wenn alles im Fluss ist. Evangelikale zwischen fundamentalistisch und postevangelikal will er die divergierenden Positionen Fundamentalismus und Postevangelikalismus darstellen und zugleich hinterfragen. Sein Buch ist im Brunnen Verlag erschienen und dient als Orientierungshilfe für Pastoren.
Das Buch gliedert sich in zehn Kapitel. Im ersten Kapitel erläutert Hardmeier das Dilemma der beiden weit auseinander liegenden Pole Fundamentalismus und Post-Evangelikalismus. Nach einem längeren Ringen um eine Definition dieser Schlagworte kommt Hardmeier zu dem Schluss, dass wir nicht von den Rändern her denken und glauben sollten, sondern von der Mitte her: „Das wahre Evangelium ist das Evangelium von Jesus Christus, das in der Mitte zwischen zwei Polen stattfindet. Die Antwort auf die Postmoderne kann weder der Rückzug von der Welt noch die Anpassung an die Gesellschaft sein. […] Unsere Zeit braucht Christen, die fundiert unfundamentalistisch glauben, denken und handeln“ (43f). Dies begründet Hardmeier im zweiten Kapitel mit dem reformatorischen Schriftprinzip der Mitte. In diesem und im dritten Kapitel arbeitet er das Schriftverständnis eines typischen Fundamentalisten und eines typischen Postevangelikalen heraus.
Im vierten und fünften Kapitel geht Hardmeier auf unsere Welt ein, und wie das Königreich Gottes dort hineinwirken will. Hier lehnt er sich immer wieder an die Missionale Theologie an und rezipiert Ansätze aus der kontextuellen Hermeneutik. Im sechsten Kapitel kommt der Autor auf das Kreuz Jesu zu sprechen und zeigt, wie zentral diese Thematik ist. Wie wir über den Sühnetod, die Rechtfertigungslehre und die Auswirkung und das Ausmaß des Kreuzes denken, prägt das Christentum im Kern. Die historische Entwicklung der Missionalen Theologie ab den 1950ern entfaltet Hardmeier im siebten Kapitel, um zu zeigen, dass das ganze Evangelium für die ganze Welt gedacht war (angelehnt an John Stott). Er postuliert, dass gerade die Missionale Theologie durch das Alte Testament ein breiteres und ganzheitlicheres Missionsverständnis gewinnt. In einem Dreiklang begründet er aus dem Alten Testament den Auftrag der Gemeinde Gottes: Erstens soll sie den Armen helfen, zweitens soll sie versuchen, Gerechtigkeit für Unterdrückte zu schaffen und letztlich möchte Gott mit und durch die Kirche Frieden schaffen für die ganze Welt (157–168).
In den letzten drei Kapiteln geht Hardmeier auf aktuelle gesellschaftliche Debatten und Stolpersteine der Bibelauslegung ein. Homosexualität, die Frauenfrage und Transgenderismus werden im achten Kapitel kurz angesprochen. Im neunten Kapitel befasst er sich mit dem Thema Hölle und stellt drei Positionen vor: Annihilation, doppelter Ausgang und Allversöhnung. Im letzten Kapitel versucht der Autor in eine Zukunft zu blicken, in der Evangelikale zuversichtlich mit der Bibel umgehen können und gleichzeitig Sorge und Liebe für diese Welt haben. Hardmeier zeigt Wege auf, wie unser Glaube in der postmodernen Welt anschlussfähig werden kann, ohne dass wir unser Bibelverständnis, unsere zentralen Dogmen und unsere ethischen Leitlinien aufgeben müssen.
In der wachsenden Methodenvielfalt der Bibelauslegung ist Hardmeiers Stimme leitgebend, sensibel und wertschätzend. Er klärt Voraussetzungen und Missverständnisse und lässt beide Seiten zu Wort kommen. Seine Argumentation aus christozentrischer Hermeneutik und missionarischem Verständnis ist plausibel und stringent. Dieses breitere und ganzheitlichere Missionsverständnis der Missionalen Theologie bedarf einer kritischen Betrachtung. Zwar ist der missionale Ansatz, dem Alten Testament durch den erwähnten Dreiklang im Bereich sozialer und ökologischer Verantwortung eine neue Gewichtung zu verleihen, grundsätzlich anerkennenswert. Dennoch erscheint dieser Fokus einseitig und vom wichtigsten Anliegen entfernt. Der grundlegende Auftrag der Mission muss die Verkündigung des Evangeliums bleiben, wie er für die Glaubensgemeinschaft des Neuen Bundes maßgeblich im Neuen Testament verankert ist. Daher sollte jede Überlegung zur Mission primär von den Aussagen des Neuen Testaments ausgehen. Diese Rezension verfolgt das Ziel, die durchweg positiv dargestellte Missionale Theologie kritisch zu reflektieren und zur Diskussion zu stellen.
Das Buch bietet im Allgemeinen wertvolle Einblicke in die Debatte. Der hermeneutische Teil ist zu kurz geraten, da sich diese brisanten Fragen vor allem an der Hermeneutik entzünden. Heutige Bibelverständnisse und sein eigenes Bibelverständnis hätten ausführlicher und tiefer reflektiert werden sollen, um dem Leser eine Vorstellung davon zu geben, wie er sich dieses gemeinsame Voranschreiten der evangelikal-westlichen Welt vorstellt.
Joshua Ganz, Pastor und Armeeseelsorger, Winterthur, Schweiz