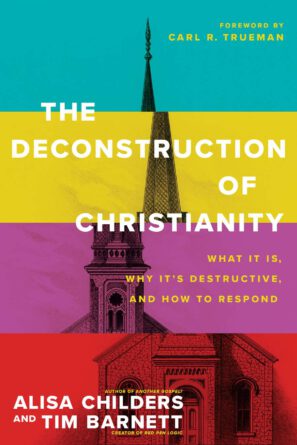Alisa Childers / Tim Barnett: The Deconstruction of Christianity
Alisa Childers / Tim Barnett: The Deconstruction of Christianity. What It Is, Why It’s Destructive, and How to Respond, Carol Stream: Tyndale, 2024, 283 S., Pb., € 18,–, ISBN 978-1-4964-7497-1
Was ist eine Glaubensdekonstruktion? Ist sie destruktiv? Wie kann man darauf reagieren? Wie hilft man einer Person, die ihren Glauben hinterfragt? Gibt es eine gute und eine schlechte Art von Fragen an den christlichen Glauben? Diesen Fragen gehen die beiden christlichen Apologeten Alisa Childers und Tim Barnett in ihrem gemeinsamen Buch nach. Aus traditioneller Perspektive legen sie ihr Verständnis, ihre Kritik und ihre Hoffnung zum Thema Dekonstruktion dar.
Die Bewegung namens Dekonstruktion ist im deutschsprachigen Raum eher unter dem Begriff Postevangelikalismus bekannt. Unter dieser Bewegung fassen die Autoren Menschen, welche sich besonders via soziale Medien stark machen für einen christlichen Glauben, der sich nicht mehr den traditionellen Dogmen wie der Autorität der Bibel, dem Sühnetod von Jesus oder einer konservativen Ethik unterordnen will. Die Autoren untersuchen diese Bewegung und analysieren sie auf eine erstaunlich aktuelle und doch zutiefst biblisch-fundierte Art. Bestsellerautorin Alisa Childers wirkt als Rednerin und Autorin. Ihr Buch Another Gospel? (Carol Stream: Tyndale, 2020) ist bei Fontis in Basel unter dem Namen Ankern auf Deutsch erschienen (2021, 32024). Tim Barnett ist Gründer des apologetischen Diensts Stand to Reason, bei dem er als Redner und Autor tätig ist.
Das Buch bietet eine tiefgründige Hinführung aus nordamerikanischer, konservativer Perspektive. Zu Beginn stellen Childers und Barnett einige Definitionen vor. Diesen werden nicht alle Leser zustimmen, das ist auch nicht nötig. Sie helfen aber ungemein, um ihre Argumentation zu verstehen. Für die Autoren ist Dekonstruktion „a postmodern process of rethinking your faith without regarding Scripture as a standard“ (26).
Anhand dieser Definition zeichnen sie in den ersten vier Kapiteln Glaubensgeschichten von Menschen nach, welche ihre Kirche, ihren Glauben an Gott und die Bibel teilweise oder ganz verlassen haben. In diesem ersten Teil unter dem im angelsächsischen Internet weit verbreiteten Hashtag #Exvangelical wird erklärt, was im Detail genau verlassen wird. Als Beispiele führen sie eine wörtliche Bibelauslegung, das Verständnis von Homosexualität als Sünde sowie die Verbindung von Glauben und Politik an (33f). Im dritten Kapitel wird gezeigt, dass dieses Phänomen keineswegs eine postmoderne, westliche Erfindung ist. Aus dem Alten und Neuen Testament werden Lebensbilder skizziert, welche einer Dekonstruktion oder zumindest großen Glaubenszweifeln sehr nahekommen. Dabei deuten die Autoren die Geschichte aus Genesis 3 sogar als Herkunft der Dekonstruktion (44f).
Im zweiten Teil des Buches wird anhand von sechs Themenfeldern das aktuelle Bild nachgezeichnet. Dabei geht es detailliert um die Glaubenskrise (Kap. 5), die Definition von Wahrheit (Kap. 6), den Unterschied zwischen Hinterfragen des Glaubens und absoluter Dekonstruktion (Kap. 7), die giftige Art der Dekonstruktion (Kap. 8) und die biblische Definition von Glauben (Kap. 9). Schließlich wird der Blick auf ein Individuum geworfen, welches seinen Glauben dekonstruiert (Kap. 10).
Im letzten Teil des Buches werden Angehörige von Zweiflern direkt angesprochen und es werden sinnvolle Abläufe geschildert, wie ein Prozess der Dekonstruktion fair und gut ablaufen könnte. Die Autoren geben praktische Tipps weiter, in welchem Umfang man sich mit solchen Themen beschäftigen sollte. Zudem sind sie in diesem Teil auch sehr selbstkritisch und kritisieren amerikanische Gemeinden, in denen Glaubensfragen a priori unterdrückt und verboten werden.
Der frische Ansatz der Autoren lädt ein, sich aktiv mit Anfragen an den christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Sie bleiben dort jedoch nicht stehen, sondern geben Leitlinien, wie das sinnvoll gemacht werden kann. Der christliche Glaube ist eine historische Religion, welche (teilweise) mit Fakten belegt werden kann. Die Auferstehung von Jesus Christus ist nicht einfach eine Option, die für den einen Bedeutung hat und für den anderen irrelevant sein kann. Das Christentum kann keine Sache persönlicher Präferenz werden. Es geht um eine Wahrheit, welche anhand von Indizien vernünftig geglaubt werden kann. Diese und weitere Erkenntnisse machen das Buch zu einem vernünftigen Ratgeber für Betroffene, Angehörige und Pastoren in diesem Themenbereich.
Dies lässt vielleicht einige Pauschalisierungen und Abwertungen gegenüber der sogenannten Dekonstruktionsbewegung verschmerzen. Besonders deutlich wird dies, wenn die Autoren eine Dekonstruktionsmethode aus einem Artikel des Journals Eikon absolut setzen (144f). In der Rezeption eines einzelnen Ansatzes vermitteln sie den Eindruck, alle Dekonstruktionsgeschichten über einen Kamm scheren zu können. De facto ist diese Bewegung, wenn man überhaupt von einer Bewegung sprechen kann, vielfältiger und nicht nur mit der einen von ihnen vertretenen Methode missionarisch aktiv.
Auf alle Fälle wünschen sich die Autoren, dass das Buch hilft, nicht nur zu verstehen, was passiert, sondern auch, wie man den Glauben im Kern bewahren und mit Klarheit und Vertrauen verteidigen kann. Diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen.
Joshua Ganz, Pastor und Armeeseelsorger, Winterthur, Schweiz