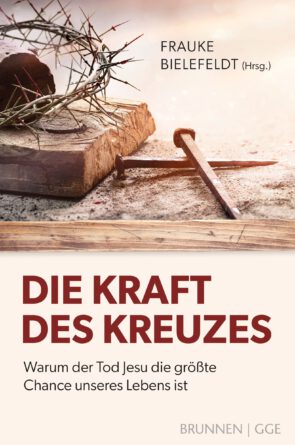Frauke Bielefeldt (Hg.): Die Kraft des Kreuzes
Frauke Bielefeldt (Hg.): Die Kraft des Kreuzes. Warum der Tod Jesu die größte Chance unseres Lebens ist, Gießen: Brunnen, 2024, Pb., 207 S., € 18,50, ISBN 978-3-7655-2164-5
Viele historisch-kritische Theologen können die Bedeutung von Jesu Sterben für unsere Errettung nicht nachvollziehen. Sie versuchen daher, diesen Kern des christlichen Glaubens zur Seite zu schieben (somit könnte man sie als „Entkerner“ bezeichnen). Ein Beispiel dafür ist das Worthaus-Video zum Thema „Die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu aus heutiger Perspektive“ (2012) von Thomas Breuer (erwähnt von der Herausgeberin, 17). Er meint am Ende seines Vortrages, dass Jesus seinem Tod „keine heilsmittlerische Bedeutung zuschreibt“. Aber als Jesus diesem Tod näher kam, hatte er – so Breuer – immerhin die (christliche?) Hoffnung, „nicht ins Nichts zu fallen“.
Auf solche „Entkerner“ reagierten baptistische Theologen, insbesondere aus dem Umfeld der charismatischen „Geistlichen Gemeindeerneuerung“. Das geschieht in diesem Sammelband, der nach der Einleitung der Herausgeberin insgesamt 18 Beiträge durchweg männlicher Theologen enthält; damit entfallen auf jeden Aufsatz etwa 10 Seiten. Am Ende der einzelnen Beiträge findet man Angaben über den Autor und die Anmerkungen.
Es gibt kein Register, aber am Beginn des Buches einen „Navigator: Was steht wo?“ (7f). Hier werden neugierig machende Fragen aufgelistet, z. B. „Wie kann Schuld übertragen werden?“ oder „Kann Gott nicht einfach so vergeben?“. Zu jeder Frage sind Beiträge (mit ihrer jeweiligen Nummer) genannt (aber keine konkreten Buchseiten). Bei der Frage „Was ist ‚Stellvertretung‘?“ stehen die Nummern von 10 Beiträgen – d. h. der Leser müsste dazu das halbe Buch durchlesen (im E-Book kann man natürlich leichter suchen).
Das Buch befasst sich mit unserer gestörten Gottesbeziehung und der Überwindung dieses Problems. Die Menschheit unterliegt dem geistlichen und dem körperlichen Tod – in den Worten von Christoph Stenschke: Die Nachkommen Adams „werden außerhalb des Paradieses geboren, jenseits der unmittelbaren Gegenwart Gottes und des Baums des Lebens“ (57, in Beitrag 4 über „Paulus und die menschliche Erlösungsbedürftigkeit“). Das Neue Testament zeigt Gottes Ausweg aus diesem Problem: „Jesus ist für uns gestorben“ (32, Tillmann Krüger in Beitrag 1: „Einer für alle“). Dass Jesus „stellvertretend“ starb, sagt das Neue Testament nicht, aber dieser Sammelband sehr oft, ohne zu erklären, was genau Jesus „stellvertretend“ für uns übernahm – und was uns daher erspart bleibt: Den geistlichen Tod? Die ewige Gottesferne hat Jesus nicht übernommen. Den körperlichen Tod? Dieser steht auch den Christen weiterhin bevor, wurde ihnen also nicht von Jesus abgenommen.
Einige Zusammenhänge sind dem Neuen Testament klar zu entnehmen: „Paulus spricht oft davon, dass wir ‚in Christus‘ sind“ (Krüger, 33); das gilt für jene, welche sich Jesus anvertrauen und sich mit ihm eng verbinden. Dadurch sind sie „mit Christus mitgestorben“ (und mitauferstanden). Diese Unterscheidung halte ich für wichtig: Ob ich mit Jesus starb, oder ob Jesus stellvertretend für mich starb (so dass ich nicht mehr sterben muss?).
Eine Besonderheit bei Jesu Sterben ist, dass bei ihm – anders als bei uns – der geistliche Tod (= Gottesferne) sowie der körperliche Tod nicht andauerten, sondern dass Jesus davon rasch befreit wurde (Apg 2,24 – und den Tod sogar besiegte: Hebr 2,14; Offb 1,18; diese drei Verse kommen im Buch nicht vor). Außerdem bleibt Jesu Sterben – obwohl zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt geschehen – in der Weise zeitlos wirksam, dass Jesus die an ihn Glaubenden geistlich in sein Sterben (und Auferstehen) mit hineinnimmt.
Durch diese Deutung (ich bin „in Christus“ und somit „mit Christus mitgestorben“) wird jenes oft als problematisch empfundene Gottesbild vermieden, wonach Gott vergeben will, das aber erst kann, wenn ein (stellvertretendes) unschuldiges Opfer gebracht wird. Außerdem erschwert die Deutung „in/mit Christus“ die Argumentation der Anhänger einer „Allversöhnung“. Diese – unterschwellig verbreitete – Lehre, auch „Wiederherstellung“ oder „Apokatastasis“ genannt, wird im Buch nicht erwähnt. Die Allversöhnung argumentiert mit Aussagen wie: „durch eine gerechte Tat werden alle Menschen gerecht gesprochen“ (Röm 5,18), oder „wenn einer für alle gestorben ist, sind sie alle gestorben“ (2Kor 5,14). Eine „stellvertretende“ Rechtfertigung lässt sich leichter auf viele/alle ausdehnen als eine grundsätzliche Einschränkung auf jene, die „in Christus“ sind.
Mehrere Beiträge behandeln wichtige Themen der Praxis, aber mitunter fehlen konkrete Einblicke. Heinrich Christian Rust bespricht dämonische Bindungen (in Beitrag 11 über das Thema „Jesus Christus erlöst aus der Macht Satans“). Rust entfaltet das Thema biblisch und wird anschließend ansatzweise praktisch: „Wie können nun solche Bindungen, Belastungen oder Besessenheiten gelöst werden?“ (156). Für mich stellt sich hier zuerst die Frage, woran ich erkennen kann, dass ein Mensch dämonisch belastet ist. Dazu gibt Rust keine Hinweise (nur, dass wir um die Gabe der Geisterunterscheidung beten sollen). Rust konnte beim Befreiungsdienst mit erfahrenen Seelsorgern zusammenarbeiten, u. a. mit Willem van Dam, John Wimber und Francis McNutt (157).
Auch Jonathan Walzer bespricht ein Thema der Praxis: Er erzählt von seinen Erfahrungen beim Erläutern von Jesu stellvertretendem Sterben in Kinder- und Jugendgruppen (Beitrag 16: „Das Kreuz für Kids“). Dabei erlebte er keine Verständnis-Schwierigkeiten bei seinen Zuhörern. Dass Kinder verstehen, dass Sünden schädlich sind, und dass uns Gott aus Liebe entgegenkam, um uns zurückzuholen – das ist wohl nachvollziehbar. Aber dass die Sünde des Einzelnen so schlimm ist, dass zur Wiedergutmachung ein Unschuldiger einen brutalen Tod erleiden musste, ist wohl schon schwieriger zu erfassen. Um die Notwendigkeit dieses dramatischen Opfers plausibel erscheinen zu lassen, werden Menschen mitunter angeleitet, sich selbst als durch und durch sündhaft zu betrachten. Aus psychologischer Sicht gibt es jedoch Bedenken dagegen, Kindern ein solches Selbstbild nahezubringen. Aber vielleicht präsentierte Walzer die Botschaft vom Kreuz anders? Darüber sagt er leider nichts, und auch nicht, woraus er schließen konnte, dass die Kinder und Jugendlichen diese Botschaft wirklich verstanden. Konkret wird Walzer vor allem bei der Angabe von äußeren Details wie „Herbst 2022“ oder „Teilnehmerzahl“… (191).
Der Sammelband enthält eine breite Palette an Beiträgen: Das gilt schon im Blick auf ihre Verständlichkeit: Leicht zu lesen sind die persönlichen Erfahrungen von Thomas Greiner (Beitrag 14: „Wie meine Predigten neue Kraft bekamen“). Dagegen sind die dogmatischen Analysen von Maximilian Zimmermann weit anspruchsvoller (Beitrag 10: „Anselms Satisfaktionslehre im Vergleich mit der biblischen Sühnelehre“). Was die Inhalte betrifft, so konzentrieren sich die Beiträge jeweils auf bestimmte Facetten, etwa auf die Trennung von Vater und Sohn am Kreuz (Michael Bendorf in Beitrag 5: „Gott zerreißt sich für uns“), auf den „Sühnetod Christi“ (Uwe Swarat in Beitrag 7 über „Theologische Kontroversen“ von ca. 1600 bis heute) oder auf die abwertende Betrachtung des Opfers im Alten Testament, besprochen von Guido Baltes (Beitrag 8: „Mit Jesus gegen Judentum und Reformation?“) und Siegbert Riecker (Beitrag 9: „Verstörende Grausamkeit, primitives Gottesbild?“).
Fazit: Der Sammelband „Die Kraft des Kreuzes“ wagt sich an ein schwieriges Thema heran. Dieses ist zentral für den christlichen Glauben. Das auch bei einem Teil der Theologen anzutreffende Unverständnis macht es nötig, sich mit diesem Thema weiter zu befassen, ausgehend von den zahlreichen biblischen Aussagen dazu, und – wie in diesem Band geschehen – mit Respekt vor den traditionellen Deutungen.
Dr. Franz Graf-Stuhlhofer, BSc, ehem. Lehrbeauftragter an Hochschulen