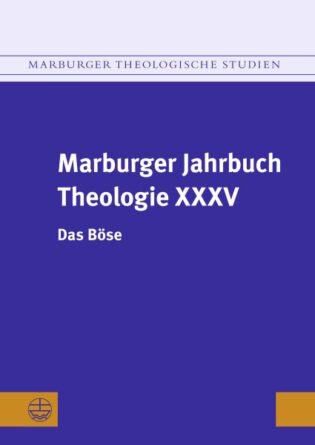Elisabeth Gräb-Schmidt / Martina Kumlehn (Hg.): Das Böse
Elisabeth Gräb-Schmidt / Martina Kumlehn (Hg.): Das Böse. Marburger Jahrbuch Theologie XXXV. Marburger Theologische Studien 143. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2024, kart., XXXI+136 S., € 34,–, ISBN 978-3-74-07682-6
Vor dem genaueren Blick in diesen Sammelband zum ewigen Problem des Bösen – die Herausgeberinnen nennen es in ihrem Vorwort mit Rüdiger Safranski das „‚schwarze Loch‘ unserer Existenz oder den ‚Abgrund, der sich im Menschen auftut‘“ (VI) – etwas mehr Formales, aber gleichzeitig auch Qualifizierendes vorneweg. Das Marburger Jahrbuch Theologie (MJTh) ist eine Reihe innerhalb der „Marburger Theologische Studien“, die 1947 von Hans Graß und Werner Georg Kümmel begründet wurden. Immer wieder wurden „heiße“ Themen aufgegriffen bzw. alte aktualisiert. Letzteres gilt auch für den hier anzuzeigenden Band.
Zur Sache und zu diesem Sammelband nun die folgenden sieben Punkte:
1. Notger Slenczka steuert keinen üblichen Beitrag bei, aber er führt auf S. IX-XXI in die fünf Beiträge sehr ausführlich und sehr gut ein. Zudem fügt er am Ende des Sammelbandes eine Rezension an zu Klaas Huizing: Lebenslehre. Eine Theologie für das 21. Jahrhundert, Gütersloh: Gütersloher, 2022. Er lobt ihren sprachlichen Duktus und bemerkt: „man liest diese Dogmatik wirklich gern“ (108). Eine ihrer Besonderheiten ist die Platzierung der Lehre von der Sünde in den Prolegomena, was zu einer „Umbildung auch der Soteriologie und damit der Christologie“ führt (114). In einer Mail an seinen Lektor schreibt Huizing sehr offen: „Ich habe die Absicht, die traditionellen Bestände der Dogmatik kräftig umzuformen“ (Lebenslehre, 34). So sehr ich Huizing kritisiere, mindestens ebenso sehr ist Slenczkas abschließender Bewertung „anregend“ zuzustimmen.
2. Nach einem ersten, kurzen Reinlesen und im Blick auf das weite Feld des Bösen zwei Beobachtungen, die erste nurmehr am Rande, die jedoch inhaltlich relevant ist: RGG, TRE und ELThG bieten jeweils einen Artikel s. v. „das Böse“; der anzuzeigende Band schließt sich dem an. Das Böse wird also neutral gefasst, nicht personal; die einzige Ausnahme findet sich auf 30f (Wolter). Fehlt dann aber nicht die Verbindung? Fordert das biblische Denken nicht primär ein personales Verständnis?
Sodann die weitere Beobachtung, dass das Böse ein zentraler Gegenstand in Religion und Theologie, in der Moral, in Religions- und Kulturwissenschaft, in der (Religions-)philosophie und in der philosophischen Ethik ist. Sieht man das Böse als Sünde oder zumindest im Kontext von Sünde (so beispielsweise Wilfried Härle: Dogmatik, Berlin: De Gruyter, ³2007, 466–481), dann gehört es zweifelsohne zu den „42 große[n] Wörter[n]“, die „Schlüssel zur Botschaft der Bibel“ sind, so Titel und Untertitel einer Veröffentlichung Egbert Ballhorns aus dem Jahr 2024. Entsprechend zahlreich und vielartig ist die Literatur zum Thema das / der Böse, besonders gehäuft nach dem Zweiten Weltkrieg / Holocaust und erneut seit wenigen Jahren (ich zählte seit Susan Neiman: Das Böse denken. Eine andere Geschichte der Philosophie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004 mindestens sechs deutschsprachige, meist psychologisch-sozial oder philosophisch orientierte Werke; in den Anmerkungen wird weitere, vor allem auch theologische Literatur genannt).
3. Friedhelm Hartenstein schlägt in seinem kultur-hermeneutischen Essay „Figuren des Bösen im Alten Testament…“ weite Bögen. In den vielen Fragen um das Böse sind mir zwei Stellen aus der Urgeschichte sehr wichtig. Die Schlange tritt in Gen 3,1 wie aus dem Nichts und völlig unerklärt aus dem Kreis der restlichen Tierwelt heraus und verführt Eva. Das / der Böse ist einfach da, wieso und warum wird nicht gesagt. Etwas zweites, nach der Sintflut sehr überraschendes ist die restitutio der Schöpfung und Gottes Treueversprechen und Verheißung in Gen 8,21f, obwohl „das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf“. Werden da nicht neutestamentliche Töne angeschlagen (vgl. beispielsweise Röm 2,4)?
4. Michael Wolter sondiert „Die Rede vom Bösen im Neuen Testament“. Gut, dass alle berücksichtigten Bibelstellen auf griechisch und deutsch abgedruckt sind. Zwei Sätze Wolters unterstrich ich mir dick: „Der Blick auf das Böse und seine Macht ist von vornherein durch die Perspektive seiner Überwindung bestimmt…“ (36). Und im Resümee: „Böse und Böses sind böse und sollen darum nicht sein“ (55). Gerne hätte ich mehr zur entsprechenden Bitte im Vaterunser („und erlöse uns vom Bösen“) und zur Apokalypse gelesen.
5. Heiko Schulz (er bedenkt das Böse im Konnex mit der Theodizeefrage) und Dietrich Korsch bringen systematisch-theologische Gesichtspunkte ein. Letzterer beginnt seinen Beitrag plakativ-thetisch: „Das Böse ist durch und durch paradox. Es ist erschreckend und anziehend zugleich, scheint voller Kraft zu stecken und verschwindet doch im Nichts.“ (86) Bevor die Vaterunserbitte „und erlöse uns von dem Bösen“ nicht erfüllt ist, muss man jedoch realistischerweise von der Präsenz des Bösen ausgehen. Das Böse scheint, was seine Orte, Zeiten, beteiligte Personen und Ausmaße angeht, grenzenlos zu sein, von sehr klein bis weltweit. Bereits auf den ersten Seiten der Bibel geht es um den / das Böse. Es gehört also von Anfang an zur menschlichen Existenz, und erst der Drachensturz in der Offenbarung (12,9) läutet das Ende der unheilvollen Geschichte ein (vgl. 20,10: die endgültige Vernichtung des Bösen).
6. Christian Polkes (als donum superadditum eingestufter) Beitrag „Vom Bösen. Biblisch-theologische Erkundungsgänge“ besteht aus leider nur acht längeren Thesen (ohne Anmerkungen). Denn er verstarb wenige Wochen nach der Frühjahrstagung 2023. Er fragt eingangs, ob das Böse in der Alltags- und Politiksprache nicht als mysterium fascinosum et tremendum mit anderem Vorzeichen versehenes Göttliches verstanden werden könne. Im Appendix schreibt er: „Das Böse bannen – das lässt sich als ein erstes Gebot für jede zivilisatorischen Leistung formulieren“ (135). Dann – auf der darauf folgenden Seite – seine letzten beiden Sätze: „Im Bösen finden Ethik und Religion eine ihrer Quellen. Das mag ernüchternd klingen, aber realistisch ist es allemal“.
7. Diese ersten sechs Leseeindrücke machen hoffentlich Lust darauf, sich privat und / oder im Kollegenkreis neu (oder wieder) auf das Thema das / der Böse einzulassen.
Pfarrer i. R. Dr. Gerhard Maier, Neuffen