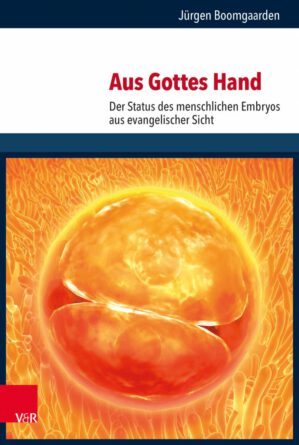Jürgen Boomgaarden: Aus Gottes Hand
Jürgen Boomgaarden: Aus Gottes Hand. Der Status des menschlichen Embryos aus evangelischer Sicht, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, geb., 235 S., € 79,–, ISBN 978-3-525-57072-2
Um den Jahreswechsel 2024/25 wurde ein Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruch-Paragrafen breit diskutiert. Auch der Rat der EKD hat sich positioniert und den Gesetzesentwurf im Grundsatz bejaht. Vor diesem Hintergrund habe ich Boomgaardens Studie gelesen, um eine theologische Einschätzung der Embryonenstatusfrage zu bekommen. Denn das ist ja die Gretchenfrage der Abtreibungsdebatten: Ab wann ist das ungeborene menschliche Leben eine schützenswerte Person?
Boomgaarden ist Professor für Systematische Theologie in Koblenz. Bei der Lektüre seines Buches darf nicht übersehen werden, dass er nur über Embryonen redet, nicht über Föten. Seine Schlüsse betreffen nur das frühe ungeborene Leben bis etwa zur achten Schwangerschaftswoche.
Boomgaarden entfaltet „konservative“ und „liberale“ Argumente, indem er deren Berechtigungen und Probleme aufzeigt. „Konservativ“ heißt hier, den Embryo möglichst früh oder gar von Anfang an als schützenswerte Person zu begreifen und „liberal“, dieses möglichst spät oder gar nicht zu tun. Boomgaarden will hier nicht einseitig Partei ergreifen, sondern eine evangelische Position im Sinne einer zeitgemäßen Theologie und Ethik darstellen.
Bei der Embryonenstatusfrage kommt er zu dem Schluss, dass der Beginn des menschlichen Daseins keinen exakten Anfang hat, sondern in eine Lebensbewegung, eine fließende Entwicklung, eine Gestaltwerdung ausgedehnt ist. Nicht jeder menschliche Embryo sei folglich eine schützenswerte Person. Der frühe Embryo sei noch kein eigentlicher Mensch, sondern nur Mensch „in seinem Möglichkeitshorizont“ (59).
Im 2. Kapitel und darüber hinaus diskutiert Boomgaarden die vielfach genannten Zeitpunkte, ab wann ein Embryo eine Person sei, allen voran die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Er räumt ein, dass der mit der Verschmelzung entstandene Embryo ein weder der Mutter noch dem Vater zugeordnetes Zellgebilde und damit etwas Neues ist. Dieses aber zum Beginn der Personwürde zu nehmen, wäre für ihn willkürlich, gar biologistisch: „Der Verschmelzungsakt eröffnet eher den Horizont personalen Werdens“ (162).
Im 4. Kapitel entwirft Boomgaarden „eine systematische Theologie des ungeborenen menschlichen Lebens“ (151). Evangelische Theologie kann für ihn nicht auf eine göttliche Offenbarung zum vorgeburtlichen Leben zurückgreifen, sondern interpretiert vom Offenbarungsgeschehen her die biologischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten. Deshalb gibt es für ihn in der Embryonenstatusfrage keine absolut gültige Antwort.
Theologisch steht für Boomgaarden fest, dass Gott seine Gnade nicht an eine bestimmte Qualität menschlichen Daseins bindet, sondern jede Person von Anfang an liebt. Aber wann und unter welchen Umständen ist der Embryo eine unbedingt von Gott geliebte und schützenswerte Person? Boomgaarden kommt zu dem Ergebnis, dass darüber letztlich die Mutter entscheidet. Das entspreche dem evangelischen Freiheitsverständnis, zu dem auch gehöre, dass Liebe zum Ungeborenen nicht eingefordert werden könne, sondern Teil einer freien Entscheidung bleiben müsse. Christen hätten aber zur Liebe und zum Schutz des Lebens von Anfang an zu ermutigen. Ob eine Abtreibung moralisch vertretbar sei, könne nicht generell geklärt werden, sondern nur im Einzelfall: „Dass Gott das Leben einer im Mutterleib heranwachsenden Kindesperson will und von daher eine Abtreibung nicht dem Willen Gottes entspricht, ist als grundsätzliche Orientierung festzuhalten, aber doch nicht in jedem konkreten Fall wahr“ (173).
Theologisch gehe es darum, dass die Eltern mit der Wahrnehmung der Schwangerschaft das in der Mutter heranwachsende Leben als eine von Gott geschaffene und geliebte Person anerkennen und annehmen. Andere Eltern mögen in ihrem Embryo keine Person sehen und sich deshalb für eine Abtreibung aussprechen. Ein Schwangerschaftsabbruch könne auch Ausdruck einer lebendigen Gottesbeziehung sein, denn entscheidend sei, wie sich Gottes Wille für die jeweilige Situation erschließe.
Wer aber den eigenen Embryo als Kind annimmt, versteht es als eine Person, die schon vorher da war und im Rückblick der Eltern mit dem Liebesakt und der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle entstanden ist. Die göttliche Annahme des ungeborenen Lebens erfolgt für Boomgaarden durch die menschliche Annahme.
Dass er den Blick der Mutter auf das Ungeborene für zentral hält, äußert sich im Buch immer wieder in spezifischen Satzkonstruktionen wie: „Die Natur erzeugt keine menschlichen Personen, die uns dann Gott reicht, sondern von ihm her zeigt sich uns das werdende menschliche Wesen als Person“ (153). Oder: „Dass der Mensch in seinen frühesten Lebensstadien durch Gott angenommen ist, hängt nicht davon ab, ob die Natur oder andere Menschen ihm eine weitere Entwicklung ermöglichen, aber lässt sich auch nicht zu der theoretischen Erkenntnis abstrahieren, dass jede früheste menschliche Lebensstufe ein von Gott angenommener Mensch sei“ (163). Und: „Mit dem Embryo allein, mit seiner biologischen Tatsache, hat Gott weder schon eine Person geschaffen noch manifestiert sich mit ihm der eindeutige Wille Gottes, personales Leben zu schaffen, auch wenn mit dem embryonalen Leben schon früh eine personale Beziehung entstehen kann, es schon Person sein kann“ (179). Boomgaarden gibt zu, dass seine Ausführungen zur Personentstehung paradox sind. Diese Paradoxie hält er aber für stimmig.
Das 2019 veröffentlichte Buch berücksichtigt nicht die gegenwärtige Diskussion, kann aber als Unterstützung der Stellungnahme der EKD zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs gelesen werden. Boomgaarden will kein strafbewehrtes Abtreibungsverbot, hält aber wie die EKD eine Schwangerschaftskonfliktberatung für unabdingbar. Denn die viel kritisierte Beratungslösung trägt beidem Rechnung: Das werdende Kind lebt von seiner freien Annahme durch die Mutter und ist zugleich als menschliches Leben selbst unbedingt schützenswert. Und um auf den Unterschied von Embryo und Fötus zurückzukommen: Wenn ich Boomgaardens Ausführungen weiterdenke, kann die Abtreibung eines Fötus auch für ihn nicht mehr vertretbar sein.
Ich bin für Boomgaardens Studie dankbar, weil sie viele Aspekte zusammenträgt und Hintergrundwissen liefert, was sonst in den Debatten oft unterbleibt. Übrigens geht er auch auf In-Vitro-Fertilisation ein. Aber das, was Boomgaarden selbst Paradoxie nennt, lässt mir keine Ruhe: Einerseits die Aussage, dass Gott den ungeborenen Menschen von Anfang an annimmt. Und andererseits das Zugeständnis, dass Menschen darüber befinden, ob ein Embryo eine Person ist oder nicht. Diese Widersprüchlichkeit kann ich für mich nicht auflösen. Offensichtlich steht mir in der Embryonenstatusfrage die katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) näher. In Form einer Kritik am besagten Gesetzesentwurf hat sich die DBK gegen die „Annahme eines abgestuften Lebensrechts“ und für „das vollgültige Lebensrecht des Kindes von Anfang an“ ausgesprochen.
Dr. Gerhard Gronauer, Theologischer Referent der Regionalbischöfin im Kirchenkreis Ansbach-Würzburg