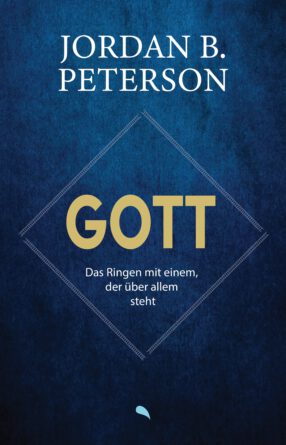Jordan B. Peterson: Gott
Jordan B. Peterson: Gott. Das Ringen mit einem, der über allem steht, Basel: Fontis, 2024, geb., 651 S., € 19,–, ISBN 978-3-03848-294-9
Noch im selben Jahr wie das englische Original des Bestsellers von Jordan B. Peterson: We Who Wrestle With God. Perceptions of the Divine, London: Penguin, 2024, erschien beim Schweizer Verlag Fontis die deutsche Übersetzung. Wer denkt, in einer postchristlichen Welt interessiert man sich nicht mehr für Gott oder die Bibel, liegt definitiv falsch. In seinem neuesten Werk präsentiert Jordan B. Peterson eine psychologische Auslegung ausgewählter biblischer Erzählungen.
Der Autor Jordan B. Peterson ist klinischer Psychologe und emeritierter Professor für Psychologie an der Universität von Toronto. Weltweit bekannt wurde er jedoch für seine kulturkritischen Aussagen gegenüber Transgenderrechten. Auch bekannt ist er als Bestseller-Autor des Buchs 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos, Toronto: Random House, 2018, welches vorwiegend praktische Tipps zur Selbstoptimierung bietet. Er hat Millionen von Followern und wird vielfach gelobt und kritisiert für seine konservativ-liberale Positionen zu Politik und Redefreiheit. Doch Peterson ist noch mehr. Er ist begeistert von antiken Texten und besonders von der Bibel, welche weit mehr aussage als viele meinen. Mit diesem neuesten Buch stellt er die Bibel zum ersten Mal auf seine große Bühne. Was vielen durch seine biblischen Auslegungsvorlesungen „Biblical Series“ auf YouTube und DailyWire+ bereits bekannt ist, dem wird hier in Druckform großen Raum gegeben. Doch was hat ein Psychologe, der sich eher als Agnostiker einordnen lässt, auf über 600 Seiten über Gott und die Bibel zu sagen?
Das Werk ist eine Art Kommentar zu Teilen der Bibel. Nach einer längeren Einleitung, die beispielsweise auch begründet, warum Peterson der Bibel überhaupt ein so großes Gewicht beimessen kann und will, geht er auf diverse Erzähltexte der Bibel ein. Er analysiert aus seinem Blickwinkel den biblischen Bericht über den Anfang dieser Welt (Kapitel 1), die Geschichte von dem Sündenfall (Kapitel 2), dem mörderischen Konflikt zwischen Kain und Abel (Kapitel 3), die Sintflut (Kapitel 4), den Turm von Babel (Kapitel 5), die Lebensgeschichte von Abraham (Kapitel 6) und schließlich die Geschichten von Mose (Kapitel 7 und 8) und Jona (Kapitel 9). Doch dies tut Peterson nicht mit einer klassischen, historisch-kritischen Brille, wie man es aus dem akademischen Raum erwarten könnte.
Als klinischer Psychologe legt Peterson die Bibel psychologisch aus. Das heißt in seinem Fall, dass er die Jung’sche Archetypenlehre und das kollektive Unterbewusstsein direkt mit den biblischen Schriften verbindet und sie aus diesem Blickwinkel versteht. Der Schweizer Psychoanalytiker Carl Gustav Jung befasste sich stark mit der Traumwelt seiner Patienten und entdeckte einige Gemeinsamkeiten. Er postulierte eine im Mensch innewohnende Gemeinsamkeit von Idealen und Handlungsfeldern. Somit erklären sich nach Peterson Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Religionen, Mythen und Geschichten weniger dadurch, dass Geschichten abgeschrieben wurden, sondern vielmehr dadurch, dass die Moral der Geschichte als Archetyp im Menschen intrinsisch vorhanden sei. Weiter vertritt Peterson die Ansicht, dass der Mensch genau diese Geschichten braucht, um moralische Entscheidungen zu treffen, die für ihn so wichtig sind. Wie wichtig Mythen und Geschichten auch für den heutigen Westen sind, zeigt Peterson nicht zuletzt mit seinen Auslegungsvorlesungen zu den Kinderfilmen Pinocchio und König der Löwen.
Der Mensch sei also nicht nur biologische Masse, er besitze auch einen psychologischen oder seelischen Teil. Mythen, und insbesondere Geschichten aus der Bibel, helfen laut Peterson den Menschen, sich selbst besser zu verstehen und in den Kontext anderer Menschen und einer Transzendenz zu stellen. Dieser Transzendenz, die Peterson oft den Gott der Bibel nennt, seien wir Menschen untertan. Der Autor vertritt dabei eine objektive Moral. Auch wenn sich Ethik seiner Ansicht nach evolutionär entwickelt, sei sie in der Psyche des Menschen angelegt.
Als Beispiel dafür nennt Peterson die Sünde durch Mord bei Kain und Abel (223; 591). Die Tat sei damals genauso falsch gewesen wie heute, das eigene Gewissen klage den Sünder an. Jedoch hätten wir heute zu Recht härtere Konsequenzen für diese Tat erarbeitet. Für Peterson hat nun diese Geschichte eher einen symbolischen und moralischen Wert. Die biblischen Geschichten legt Peterson größtenteils symbolisch aus und sieht in ihnen nur eine geringe historische Komponente.
Ein weiteres Beispiel für seine psychologische Auslegung, wie man sie im deutschsprachigen Raum bisher u. a. von Eugen Drewermann (*1940) kennt, ist die Untersuchung der Sintflut. Peterson schreibt: „Wir alle tun im Laufe unseres Lebens das, wozu Noah aufgefordert wird“ (236). Die Sintflut ist für Peterson aus naturwissenschaftlicher Perspektive vermutlich nicht historisch, auch wenn er dies nicht explizit formuliert. Die Arche beispielsweise sieht er nicht als ein aus Holz gebautes Boot, sie stehe symbolisch für eine durch Integrität gestärkte Psyche (593). Noah und seine Aufgabe seien für jeden Menschen wichtig, denn jeder sollte in seiner chaotischen Welt seinen Beitrag dazu leisten, dass das Chaos durch gute Taten abgewendet wird (s. a. 220, 223).
Peterson hat viele spannende Anekdoten, naturwissenschaftliche und tiefenpsychologische Erkenntnisse in die Auslegung der biblischen Geschichten hineingeflochten. Er misst der christlichen, objektiven Moral einen hohen Wert zu und kämpft gegen einen reinen Naturalismus, was aus biblisch-theologischer Sicht durchaus zu begrüßen ist. Erkenntnisreich sind auch seine psychologischen Anmerkungen zu den biblischen Texten, die er oft direkt auf den Leser anwenden kann.
Über allem jedoch scheinen mir Petersons Denkrahmen und Prämissen vorbelastet zu sein. Wenn er seine philosophischen und theologischen Ausführungen vorträgt, scheint mir dies nicht im Sinne und Geiste der Bibel zu geschehen. Seine Auslegungen sind packend und nachvollziehbar, doch legt er die Texte so aus, wie sie ursprünglich verstanden werden wollten? Sein Denkrahmen, Weltbild und Menschenbild haben viele Ähnlichkeiten mit dem Christentum, jedoch scheint mir seine Hermeneutik weit entfernt von einer biblisch erneuerten Theologie: Welchen Mehrwert hat eine biblische Geschichte wie beispielsweise die Sintflut, wenn sie nur eine psychologische Komponente hat? Warum ist dann ausgerechnet die Bibel wichtig? Mythen und Geschichten von einer Flut findet man in fast allen Kulturen. Zudem wird bei Petersons Hermeneutik nicht klar, ob er die Bibel nur hintergründig psychologisch auslegt, oder ihr vordergründig auch einen grundsätzlichen Literalsinn zugesteht. Weitere Bedenken habe ich bei seinem Gottesbild. Steht Gott für ihn wirklich über allem und insofern auch außerhalb des Menschen? Peterson leitet den Menschen nicht dazu an, Kraft und Hilfe zur Überwindung von Sünde, oder in seinen Worten zur Verbesserung seines Selbst, von Gott zu bekommen. Die Möglichkeit dazu besitzt der Mensch offenbar in sich selbst. Damit ähnelt sein Gottesbild eher dem der Gnosis oder des Pantheismus. Laut Peterson kann man sich von seinem anklagendes Gewissen selbst befreien, indem man mit sich selbst und mit seinem Umfeld in Einklang kommt. Dabei wird jedoch die Verantwortung dem gegenüber vernachlässigt, der wirklich über allem steht, der Schöpfer von Himmel und Universum.
Das Buch bietet eine spannende Re-Lektüre zur Bibel und gibt interessante Einsichten, die den christlichen Leser sicherlich herausfordern werden. Diese Herausforderung darf und sollte man gerade bei Peterson annehmen, weil er einerseits ein so breites und großes Publikum anspricht und andererseits nebst Abweichungen durchaus Ähnlichkeiten zum christlich-biblischen Weltbild zeigt.
Joshua Ganz, Pastor und Armeeseelsorger, Winterthur, Schweiz