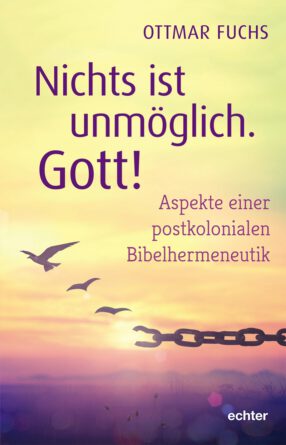Ottmar Fuchs: Nichts ist unmöglich
Ottmar Fuchs: Nichts ist unmöglich. Gott! Aspekte einer postkolonialen Bibelhermeneutik, Würzburg: Echter, 2023, kt., 248 S., € 19, –, ISBN 978-3-429-05849-4
Der japanische Autohersteller Toyota hat in den 1990ern mit seinem Werbeclip „Nichts ist unmöglich“ einen großen Erfolg gelandet. Ähnlich formuliert bereits viele Jahrhunderte früher ein weiser Rabbi aus Nazareth: „Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott; denn für Gott ist alles möglich“ (Mk 10,27). Autor Ottmar Fuchs findet in diesen Worten Gottes absolute Unermesslichkeit. Den Werbeslogan wählt er also bewusst als Titel, um Gott für seine Sache zurückzugewinnen. Sein Anliegen: Eine notwendige und postkoloniale Transformation in Religionen. Der Untertitel definiert weiter: Die Monografie ist ein Weckruf, Aspekte postkolonialer Hermeneutik ernst zu nehmen und umzusetzen. Sie versteht sich als ein Grundlagenwerk, welches in die postkoloniale Hermeneutik einführen will.
Der Autor Ottmar Fuchs (geb. 1945) war von 1998 bis zu seiner Emeritierung 2014 als Professor für Praktische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen tätig. Fuchs wurde bekannt durch seine Kritik am Zölibat, am Verbot des Priesteramts für Frauen, am Ausschluss nicht-katholischer Christen von der Eucharistiefeier und an der Verweigerung einer kirchlichen Segnung homosexueller Paare.
Das Buch ist eine grundsätzliche postkoloniale Kritik an der Rezeption der Bibel und gar an der Bibel selbst. Doch was ist postkolonial? Postkolonial bezeichnet allgemein einen theoretischen und kulturellen Ansatz, der sich mit den Auswirkungen und Nachwirkungen des Kolonialismus auf Gesellschaften, Kulturen, Identitäten und Machtverhältnisse beschäftigt. Es bezieht sich dabei nicht nur auf die historische Phase nach dem Ende der Kolonialherrschaft, sondern auch auf die Art und Weise, wie koloniale Strukturen und Denkweisen weiterhin in der Gegenwart präsent sind.
Speziell hier meint postkolonial auch Befreiung – Befreiung von Nötigung und Religion (9). Die Kirche ist für Fuchs, wie andere religiöse Institutionen auch, oft als Begrenzung wahrgenommen worden. Das Heil gibt es für alle, die sich innerhalb der Grenze, innerhalb der kirchlichen Schranken befinden. Doch laut Fuchs gibt es noch „Anteile in den Religionen, wie etwa in den mystischen Traditionen, in denen Gott so […] unermesslich wahrgenommen wird, dass alle Menschen […] von Liebe und Freiheit profitieren“ (9). Und so heißt die Leitfrage seines Buchs: Kann die Gottesbeziehung selbst zum Raum permanenter Entgrenzung des säkularen und religiösen Heils werden?
Das Buch gliedert sich in vier Teile. Fuchs zeigt in der Einleitung, wie die Bibel imperialistische und ungerechte Texte enthalte, die kritisch betrachtet werden müssten. Er plädiert dafür, diese Passagen in ihrer kolonialen und patriarchalen Wirkungsgeschichte offenzulegen. Im ersten Hauptteil verortet Fuchs postkoloniale Perspektiven in der aktuellen Antisemitismusdebatte. Fuchs fordert eine Sichtweise, welche die tief verankerten kolonialen Denkweisen in Theologie und Kirche hinterfragt. Im zweiten Hauptteil beschreibt er Gott im Alten und Neuen Testament als ambivalent und gewalttätig. Er greift zudem die Frage nach der Existenz der Hölle auf und diskutiert sie im Licht der postkolonialen Hermeneutik. Im letzten Teil hebt der Autor die Bedeutung von Freiheit und die transformative Kraft hervor, sich von Gott bedingungslos lieben zu lassen. Dies versteht er als zentralen Impuls für ein entgrenztes und befreiendes Gottesbild.
Fuchs’ Werk stellt evangelikale Leserinnen und Leser vor mehrere Herausforderungen, bietet jedoch auch interessante Denkanstöße. Sein Ansatz, Gott vor allem in der Schwachheit und im Leiden zu verorten, erinnert an die paulinische Theologie des Kreuzes. Gleichzeitig wirft Fuchs’ Theologie grundlegende Fragen auf zu seinem Gottesbild, seinem selektiven Umgang mit der Bibel und soteriologischen Aspekten.
Das Gottesbild: Die Absage an einen „allmächtigen“ Gott im klassischen Sinne mag für evangelikale Christen irritierend wirken, da sie im Allgemeinen die Allmacht Gottes als zentrale Glaubenswahrheit betrachten. Die Herausforderung besteht darin, zu reflektieren, wie sich Gottes Allmacht und sein Mitleiden miteinander verbinden lassen, ohne in einseitige Verkürzungen zu verfallen.
Hermeneutik: Während Fuchs einerseits auf zahlreiche Bibelstellen verweist, liegt sein Fokus andererseits oft auf einer selektiven Lesart, welche die Perspektive der Schwachen betont. Evangelikalen Lesern könnte auffallen, dass Aspekte wie die Souveränität Gottes oder Gottes gerechtes Gericht wenig Beachtung finden. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die biblische Botschaft in ihrer Ganzheit zu würdigen. Die lokalgeschichtliche, postkoloniale Auslegung erscheint hier zu selektiv und subjektiv, um sie als allgemein- und global-gültige Methode mit Gewinn nutzen zu können.
Soteriologie: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Vorstellung eines ‚säkularen Heils‘, die Fuchs implizit zu vertreten scheint. Aus evangelikaler Perspektive wirft dies grundlegende Fragen auf: Kann Heil unabhängig von einer expliziten Beziehung zu Jesus Christus gedacht werden? Die Betonung eines säkularen Heils führt möglicherweise zu einer Relativierung des biblischen Heilsgeschehens und könnte die zentrale Rolle von Christus für die Erlösung infrage stellen.
Was den Schreibstil und Aufbau des Buches betrifft, ist zu bemerken, dass Fuchs stark im bibelwissenschaftlichen, katholischen Fachjargon verhaftet bleibt. Dies erschwert es, sein Anliegen klar und konkret herauszuhören, da vieles nur implizit kommuniziert wird oder nur mit entsprechendem Hintergrundwissen verstehbar ist. Zudem konzentriert sich das Werk weniger auf klassische Themen wie die Inspiration der Bibel und die Autorität der Schrift. Dies macht das Buch weniger zu einer klassischen Grundlagenhermeneutik, sondern eher zu einer theologischen Standortbestimmung mit starkem postkolonialem Impuls.
Nichts ist unmöglich, Gott! ist ein herausforderndes Werk, das bekannte Glaubenswahrheiten grundlegend hinterfragt. Evangelikale Leser müssen sich dabei auf eine kritische Auseinandersetzung einlassen, finden jedoch auch einige Anknüpfungspunkte. Ottmar Fuchs fordert dazu auf, sich von einem statischen Gottesbild zu lösen und stattdessen ein dynamisches, oft überraschendes Handeln Gottes zu entdecken. Diese Einladung verdient es, Beachtung zu finden – auch über konfessionelle Grenzen hinweg.
Joshua Ganz, Pastor und Armeeseelsorger, Winterthur, Schweiz