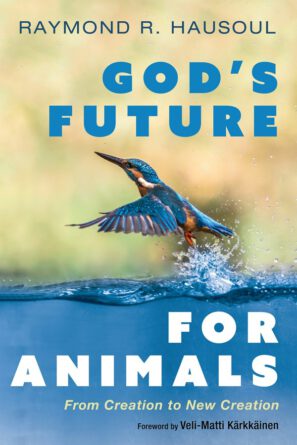Raymond R. Hausoul: God’s Future for Animals
Raymond R. Hausoul: God’s Future for Animals. From Creation to New Creation, Eugene: Wipf & Stock, 2023, Pb., 266 S., € 37, –, ISBN 978-1-6667-0340-5
Raymond R. Hausoul, angegliederter Wissenschaftler an der Evangelischen Theologischen Faculteit (ETF) in Leuven (Belgien) greift mit diesem Buch ein stark vernachlässigtes Thema in der christlichen, und insbesondere der evangelikalen Theologie auf: die Stellung der Tiere. Der Autor wagt ein breit angelegtes biblisch-theologisches Panorama. Die ersten fünf Kapitel sind den Eröffnungskapiteln des Genesisbuches gewidmet, wobei die Frage des Todes von Tieren in der ursprünglichen Schöpfung einen breiten Raum einnimmt (Kapitel 4 insbesondere zur Frage der tierischen oder vegetarischen Nahrung und Kapitel 5 zum Thema der aus Fellen hergestellten Kleidung). Kapitel 6 behandelt den Bund mit Noah; Kapitel 7 Tierrechte und Verantwortlichkeit von Tieren in der Tora. Kapitel 8 und 9 interessieren sich für Tiere in den alttestamentlichen Propheten, und Kapitel 10 für die Haltung von Jesus zu Tieren. Kapitel 11 bis 13 konzentrieren sich dann auf das, was man aus den biblischen Texten zur Zukunft der Tiere ableiten kann: Kapitel 11 stellt die Frage, ob die neue Schöpfung eine völlige Neuschöpfung darstellen wird oder ob es sich um eine Erneuerung der ersten Schöpfung handelt (der Autor schließt auf eine Kombination von Kontinuität und Diskontinuität); Kapitel 12 entwirft ein theologisches Bild der Tiere im Eschaton; und Kapitel 13 stellt abschließend die Frage, ob das Eschaton sich durch vegetarische Nahrung auszeichnet (es scheint mir, dass der Autor die Frage mit Ja beantworten möchte, aber auch um Schwierigkeiten dieses Ansatzes weiß).
Hausoul greift für seine weitreichende theologische Abhandlung auf umfangreiche Quellen zurück (das Literaturverzeichnis umfasst 19 Seiten, erstaunlicherweise keine Arbeit von Bernd Janowski), zitiert jüdische und christliche Exegeten aus unterschiedlichen Epochen und ergänzt die Arbeit am biblischen Text durch Ausflüge in die alte und neue Geschichte. Die Arbeit wird abgerundet durch Verzeichnisse der zitierten Autoren und Werke und ein Themenverzeichnis, die es dem Leser ermöglichen, sich leicht im Buch zurecht zu finden.
Leider fehlt es dem Werk an präzisen methodologischen Grundlagen. Nur in der Behandlung der alttestamentlichen Propheten legt der Autor dar, wie er deren Bildsprache auslegt (136–143). In der sehr ausführlichen Behandlung der Genesistexte fehlt eine klare Erörterung ihres literarischen Genres. Der Autor führt wohl die künstlerische Gestaltung von Genesis 1 aus (er spricht von der „artificial structure of Genesis 1“ [7]; auch an anderen Stellen spürt man, dass Englisch nicht die Muttersprache des Autors ist). Hausoul erwähnt auch einige jüdische Exegeten (insbesondere Rashi [9]), welche die Schöpfungstage nicht wörtlich auslegen, lässt den Leser aber alleine mit der Frage, welche Lesart der ursprünglichen Autorintention entspricht. Was die Schlange angeht, listet der Autor verschiedene Meinungen auf, warum sie als Symbol des Bösen in Genesis 3 gewählt wurde, versucht aber nicht, zwischen ihnen zu wählen (43–45). In einem späteren Kapitel scheint der Autor nun die Schlange wörtlich zu verstehen, ohne dies weiter zu begründen, sondern schließt aus dieser Lesart, dass die Bibel Tieren moralische Verantwortlichkeit zuschreibt, so dass sie für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden können (66). Dies dient als Erklärung, warum sich Tiere heute nicht rein vegetarisch ernähren: „God gave all living creatures freedom“ – eine Freiheit, welche die Tiere dazu missbraucht haben, dem schlechten Beispiel der Schlange zu folgen, so der Autor (66). Bei anderen Elementen der Genesistexte räumt jedoch Hausoul nicht-wörtlichen oder sogar völlig spekulativen Interpretationen einen großen Platz ein (wie z. B. der Ansicht des antiken Rabbis Eleazar, dass die Namensgebung der Tiere durch Adam bedeutet, dass Adam Sex mit den Tieren hatte [41]), lässt aber oft den Leser alleine mit der Frage, wie glaubwürdig solche Auslegungen ist (im konkreten Fall erwähnt er die Möglichkeit, dass es sich um „intellectual or spiritual sex“ handeln könne, ohne zu erklären, was dieses Oxymoron bedeuten soll).
Überhaupt gewinnt der Leser den Eindruck, dass Hausoul sich bei der Exegese im Wesentlichen auf das Sammeln von möglichen Interpretationen beschränkt, ohne dass ersichtlich wird, nach welchen Kriterien er bei der Auswahl der zitierten Autoren vorgeht und wie zwischen den verschiedenen Interpretationen zu entscheiden ist.
Ebenso bleibt unklar, nach welchen Kriterien der Autor die zu behandelnden biblischen Texte ausgewählt hat und wie er entschieden hat, welche Schwerpunkte dabei zu setzten sind. So beschränkt er sich nicht auf das, was Genesis 1 speziell zum Thema Tiere beizutragen hat, sondern behandelt ausführlich alle Schöpfungstage, obwohl es dazu ausreichend Literatur gibt und der (informierte) Leser nichts Neues erfährt (7–20). Im Gegenzug dazu werden die seltener behandelten Hiobtexte, die die längsten biblischen Texte zur Tierwelt überhaupt sind, nur beiläufig erwähnt. Ihr Beitrag zu einem biblischen Verständnis des Tieres bleibt somit weitestgehend im Dunkeln. Ebenso wird der bedeutendste neutestamentliche Text zur eschatologischen Hoffnung der nicht-menschlichen Natur – Römer 8,19–22 – wohl mehrfach erwähnt; aber auch hier bleibt der Autor eine ausführliche Behandlung schuldig und die verschiedenen Auslegungsansätze werden nicht genannt, geschweige denn argumentativ gegeneinander abgewogen (150f, 191f).
Aufs Ganze betrachtet bleibt vorliegende Abhandlung hinter den geweckten Erwartungen zurück. Der Leser kann hier wohl eine Reihe von Informationen zum Thema finden; ein exegetisch fundiertes Gesamtbild entsteht aber nicht. Dennoch ist Raymond R. Hausoul dafür zu danken, ein stark vernachlässigtes Thema aufgegriffen zu haben.
Dr. Lydia Jaeger ist Dozentin und akademische Beraterin am Institut Biblique de Nogent-sur-Marne (Frankreich) und akademische Direktorin des Centre d’enseignement et de recherche interdisciplinaire évangélique (CERIE). Sie ist assoziiertes Mitglied des St. Edmund’s College (University Cambridge, England).