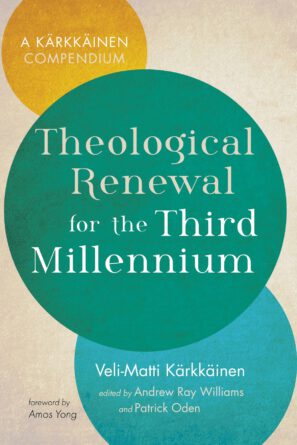Veli-Matti Kärkkäinen: Theological Renewal for the Third Millenium
Veli-Matti Kärkkäinen: Theological Renewal for the Third Millenium. A Kärkkäinen Compendium, Hg. Patrick Oden / Andrew Ray Williams, Eugene, OR: Cascade Books, 2022, Pb., xxix+321 S., € 37,60, ISBN 978-1-6667-1354-1
Der finnische Systematiker Veli-Matti Kärkkäinen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als bedeutender Theologe profiliert. Seit dem Jahr 2000 lehrt er am Fuller Theological Seminary in Pasadena, Kalifornien, und ist zudem Dozent an der Universität Helsinki. Seine akademische Laufbahn führte ihn auch nach Bangkok, Thailand, wodurch er Perspektiven aus drei verschiedenen Kontinenten in seiner Arbeit vereint. Hinzu kommt eine doppelte geistliche Beheimatung: das finnische Luthertum und die Pfingstbewegung (xxvii). In seinem autobiografischen Vorwort spricht Kärkkäinen zudem von drei weiteren „Bekehrungen“: einer ökumenischen, einer globalen und einer interreligiösen (xxviii).
Sein theologischer Ansatz besteht darin, in der Nachfolge der deutschen Theologen Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg und Paul Tillich, eine zeitgenössische, konstruktive christliche Theologie zu entwickeln, die hermeneutische und kritische Werkzeuge anwendet, um die christliche Theologie für das dritte Jahrtausend bereit zu machen. Im Unterschied zu Pannenberg, dessen Hauptgesprächspartner die Philosophie war, wählt Kärkkäinen einen vergleichenden Ansatz, der kontextuelle, pluralistische und interreligiöse Perspektiven stärker miteinbezieht. Sein fünfbändiges Hauptwerk A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World (2013-2017) ist das umfassende Ergebnis dieses Vorhabens.
Der vorliegende Band, Theological Renewal for the Third Millennium, ist ein ergänzendes Kompendium, das 17 seiner Essays aus den Jahren 2006 bis 2020 versammelt. Die Beiträge sind in die fünf Teile Methodik, Systematische Theologie, Ökumenische Theologie, Interreligiöse Theologie und Interdisziplinäre Theologie gegliedert. Diese Essays eröffnen ein Fenster zur Theologie von Kärkkäinen für diejenigen, denen er noch nicht vertraut ist, und zugleich erweitern sie das Verständnis seiner „umfassenden theologischen Vision“ (xi, alle Übersetzungen durch den Rezensenten) wie der Dekan des Fuller Theological Seminary, Amos Young, in seinem Vorwort hervorhebt.
Herausgeber des Bandes sind Patrick Oden und Andrew Ray Williams. Ihre doppelte Vorstellung Kärkkäinens passt sehr gut zu seiner Methodik, in der er die Bedeutung von Biografie und persönlichem Narrativ betont (29). Kärkkäinen selbst unterstreicht in seinem Essay zur „Göttlichen Gastfreundschaft und Gemeinschaft“ (43–58), dass „alle Theologie kontextuell“ sei (53), weshalb er oft persönliche Erfahrungen in seine theologische Arbeit integriert. In beiden Perspektiven der Vorstellung wird der enge Bezug zu Moltmann und Pannenberg hervorgehoben. Oden, der bei Kärkkäinen studierte und inzwischen als außerordentlicher Professor mit ihm bei Fuller zusammenarbeitet, berichtet, dass die Studenten nur darauf warteten, bis der Name „Pannenberg“ fiel (xviii), da Kärkkäinen ihn in jeder Vorlesung zitierte. Wenig überraschend sind Moltmann und Pannenberg daher die am häufigsten genannten Gesprächspartner in den Essays.
Einer der größten Vorteile dieser Essays und der Theologie von Kärkkäinen liegt in seinen vielfältigen Gesprächspartnern von allen Kontinenten und Religionen: Ob er über Individualismus und Gemeinschaft mit dem Asiaten Yeow Choo Lak und dem Kenianer John Mbitit spricht (9), die Trinität mit Metropolit Zizioulas diskutiert (51) oder die Sakramente mit Hans Küng (122) und Roger Haight erörtert (129) – Kärkkäinen bringt Theologen und Denker aus unterschiedlichen Kontexten miteinander ins Gespräch. Er zitiert aus der buddhistischen Schrift, der Dhammacakkappavattana Sutta (192), und diskutiert diese mit dem thailändischen Theologen Satanun Boonyakiat (195), um nur eine kleine Auswahl zu nennen. In der Bibliographie werden 394 unterschiedliche Autoren angeführt. Die vielen unterschiedlichen, dazu globalen Perspektiven, die Kärkkäinen miteinander ins Gespräch bringt, sind sehr erfrischend und regen zum Weiterlesen und -denken an.
An diesem Punkt zeigt sich aber auch eine potenzielle Schwachstelle: Kärkkäinens Eifer für den ökumenischen und interreligiösen Dialog birgt die Gefahr, dass die eigenen theologischen Grundlagen in den Hintergrund treten. Obwohl er ordinierter lutherischer Pastor ist, kommen Bibelstellen und Bekenntnisbezüge in seinen Essays überraschend selten vor. Dagegen stellt er die These auf, dass eine pfingstliche Geist-Christologie ein von „Gott gesandtes Korrektiv“ gegen eine christologische Verkürzung im Apostolischen Glaubensbekenntnis sein könnte (26). Auch in Fragen nach Gottes Absicht für die Menschen orientiert er sich eher an soziologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie der Befreiungstheologie, statt klassisch lutherisch die Rechtfertigungslehre zu fokussieren (44).
Kärkkäinen ist sich dieser Problematik offenbar bewusst, wie sein Essay über „Erlösung als Rechtfertigung und Theosis“ (101–113) belegt. Er referiert die Position der sogenannten finnischen „Neuen Luther-Interpretation“, die wiederum der „Neuen Paulusperspektive“ folgt, und eng verbunden mit Tuomo Mannermaa ist, dass Luthers Position, im Unterschied zu späteren Lutheranern, nicht im Widerspruch zur orthodoxen Lehre der Theosis des Menschen steht. Obwohl er mit dieser Position sympathisiert, folgt er der sogenannten Mannermaa-Schule nicht gänzlich und weist auf die Schwierigkeiten hin (109–111). Dennoch kommt er zum Schluss, dass die ökumenischen Differenzen zwar ernstgenommen werden müssen, aber doch letztlich dem Kontext der Reformations- und Gegenreformationszeit entspringen und nicht zwangsläufig heutige Gespräche belasten müssen (112). Und er ergänzt, dass eine Neubetrachtung der „alten christlichen Lehren“ helfen kann, auf Basis der Vergöttlichung des Menschen mit anderen Religionen wie dem Hinduismus und dem Buddhismus sowie afrikanischer Spiritualität ins Gespräch zu kommen, und dass so ökumenische Sackgassen überwunden werden können (113).
So anregend viele seiner Gedanken auch sind, gerade in diesem Bereich des ökumenischen und interreligiösen Dialogs lauert die Gefahr, eigenen Überzeugungen und Lehren zu verlieren. Eine stärkere Bindung an Schrift und Bekenntnis würde seine Theologie vor solchen Fallstricken schützen.
Dr. Martin P. Grünholz, Dozent für Systematische Theologie und Kirchengeschichte an der Biblisch-Theologischen Akademie bei Forum Wiedenest