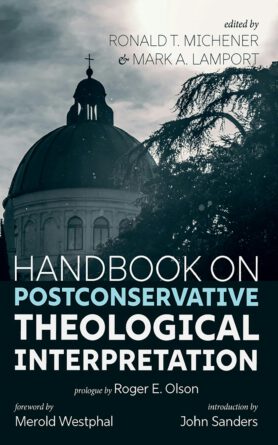Ronald T. Michener / Mark A. Lamport (Hg.): Handbook on Postconservative Theological Interpretation
Ronald T. Michener / Mark A. Lamport (Hg.): Handbook on Postconservative Theological Interpretation, Eugene, OR: Cascade Books, 2024, xliii+756 S., kt., US $ 69,–, ISBN 978-1-6667-4405-7
Die Beiträge dieses großen Sammelbandes stehen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt: Postkonservative Bibelauslegung. Dieser Begriff taucht so im Deutschen (noch) kaum in der Literatur auf, und doch ist das Phänomen und die Praxis von postconservative theological interpretation auch im deutschsprachigen Raum seit dem Einfluss der Postmoderne (bzw. Spätmoderne) auf die Theologie spürbar. Dieser Band erklärt und begründet nicht dogmatisch oder argumentierend diese eine Art der Bibelauslegung gegenüber anderen kontemporären Methoden. Vielmehr wählt dieses Handbuch einen deskriptiven Weg, die vorgefundene Vielfalt innerhalb des breiteren Evangelikalismus von Bibelauslegungen im 21. Jahrhundert zu zeigen. Den Herausgebern ist bewusst, dass sie damit über die „klassische, fundamentale oder konservative Perspektive innerhalb evangelikaler Theologie hinausgehen“ (xxi, Übersetzung des Rezensenten).
Doch was ist diese postkonservative Bibelauslegung, die nicht pauschal mit dem auch im deutschsprachigen Raum genutzten Begriff Postevangelikalismus gleichgesetzt werden sollte? Zuerst meint postconservative eben genau nicht postevangelical, denn die Autoren verstehen sich immer noch innerhalb der evangelikalen Tradition (xxv). Postconservative bindet sich aber nur noch dort an traditionelle Glaubenskonstrukte, solange sie mit der Bibel verteidigt und begründet werden (xxv). Nicht zuletzt, so schreibt Roger E. Olson im Prolog, haben postkonservative Denker gemeinsam, dass sie nicht von einer irrtumslosen Bibel ausgehen, wie sie üblich im Evangelikalismus und insbesondere in der Chicago-Erklärung definiert wurde (xxvi). Andererseits betont Olson, dass postkonservative Theologie auch nicht so progressiv sein will, dass man sie mit der liberal-universitären Theologie gleichsetzen könnte oder sollte.
Dabei sei der Wunsch der 45 Mitautoren, Engagement, und nicht Zustimmung zu erreichen. Die Autoren möchten den Leser herausfordern, die Art, wie man die Bibel versteht und über sie denkt, zu hinterfragen, ohne dabei die Wahrheit zu verlieren (xxii). Zudem ist es für die Autoren wichtig, aus dem Spektrum „links / rechts“ auszubrechen, wo ein Theologe entweder konservativ oder liberal ist. Die postconservative theology wurde bis zu einem gewissen Maß sicherlich von der Yale Schule und ihrer postliberal theology inspiriert.
Dieses große Buch stellt nun nach mehreren Einleitungen von bekannten Theologen (Merold Westphal, Roger E. Olson und John Sanders) diverse Arten zeitgenössischer Bibelauslegung vor. Die ersten neun Kapitel richten sich nach dem Oberthema postmodern philosophical interpretation, Kapitel 10–22 handeln von doctrinal interpretation und im dritten Teil des Buches mit den Kapiteln 23–33 geht es um contextual interpretation. Die letzten beiden Hauptteile gehen einerseits auf scripture and interpretation (Kapitel 34–42) und andererseits auf pastoral-applicational interpretation (Kapitel 43–46) ein. John Franke und Telford Work schreiben für jedes Kapitel jeweils eine Art Nachwort, um die beschriebene Methode kritisch zu würdigen. Exemplarisch werden dabei zwei Autoren und ihre Bibelauslegungen näher betrachtet.
Der progressive Theologe Gregory A. Boyd widmet sich beispielsweise im zweiten Hauptteil einer cruciform hermeneutics, einer im deutschsprachigen Raum durch Manuel Schmid bekannt gewordenen kruziformen oder Jesus-zentrierten Hermeneutik, welche die Gewalttexte des Alten Testaments durch die Brille des Kreuzes aus der Sicht des 21. Jahrhunderts neu verstehen will.
Im vierten Abschnitt des Buches schreibt Peter Enns über eine deconstruction hermeneutics. Er beschreibt unser aktuelles Phänomen, dass viele Christen ihre Glaubenskonstrukte hinterfragen. Für Enns ist dies aber weder beunruhigend noch neu. Denn die Hermeneutik der Dekonstruktion findet bereits im Alten Testament Berichte von Menschen, die ihre Glaubensfundamente hinterfragen und überprüfen. Er nennt das Problem hebräischer Sklaven bei hebräischen Besitzern, König Manasse und sein Verhalten, die Rolle der Assyrer als Gottes Werkzeug und weitere Beispiele.
Des Weiteren finden sich in diesem Buch Methodenbündel zu postmoderner Hermeneutik, politischer Theologie und Hermeneutik und missionaler Hermeneutik. Besonders eigenständig und horizonterweiternd erscheint der dritte Sektor unter dem Titel kontextueller Interpretation. Dort werden Methoden wie interkulturelle, racial identity, asiatische, schwarze, afrikanische, feministische und indigene Interpretationen vorgestellt.
Besonders hilfreich ist der Band für Theologen, welche sich mit dem Thema der postkonservativen Bibelauslegung beschäftigen oder selber in dieser Tradition stehen. Einzelne Kapitel erhellen neue Strömungen innerhalb des Evangelikalismus aus der Sicht jener, die diese Bibelauslegung praktizieren. Dementsprechend fehlt eine kritische Würdigung aus tendenziell konservativer Sicht. Dies hätte mitunter geholfen, einzelne Methoden auf ihre Lücken hin zu untersuchen. Aber auch so ist der Band sehr hilfreich, um diese neueren Methoden einmal wahrzunehmen. Zudem hat es auch einen didaktischen Mehrwert, 45 unterschiedliche Autoren kennenzulernen, welche teilweise sehr weit weg von der eigenen Tradition zu liegen scheinen, sich aber selbst auch im Bereich des Evangelikalismus einordnen. Diese Fülle und Vielfalt ist auf alle Fälle horizonterweiternd, auch wenn man nicht mit allem übereinstimmen muss.
Joshua Ganz, Pastor und Armeeseelsorger, Winterthur, Schweiz