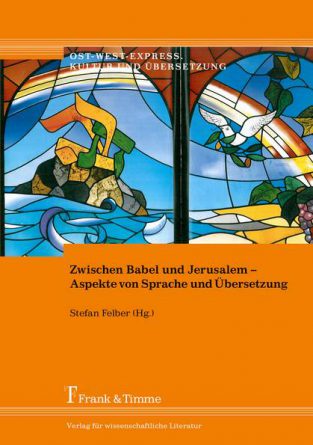Stefan Felber (Hg.): Zwischen Babel und Jerusalem
Stefan Felber (Hg.): Zwischen Babel und Jerusalem. Aspekte von Sprache und Übersetzung, Ost-West-Express. Kultur und Übersetzung 34, Berlin: Frank & Thimme, 2018, Pb., 260 S., € 24,80, ISBN 978-3-7329-0501-0
Stefan Felber, Dozent für Altes Testament am Theologischen Seminar St. Chrischona, führt mit diesem Sammelband seine Studien zu den Voraussetzungen und Auswirkungen moderner Bibelübersetzungen fort (vgl. ders., Kommunikative Bibelübersetzung. Eugene A. Nida und sein Modell der dynamischen Äquivalenz, 2. Aufl., Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2016). Der zusätzliche Erkenntnisgewinn des vorliegenden Bandes besteht in seinem interdisziplinären Ansatz und dem darin gegebenen Kontext der Auseinandersetzung über Bibelausgaben. Drei der elf Aufsätze stammen von Stefan Felber. Die anderen Autoren sind Philosophen (Konrad Paul Liessmann, Harald Seubert) oder Schriftsteller (Felix Philipp Ingold, Werner Creutziger), die sich mit Felber in der kritischen Beobachtung der gegenwärtigen Sprachentwicklung sowie im sprachphilosophischen Interesse treffen.
Die Gliederung der Aufsatzsammlung basiert auf dem Dreiklang von Analyse (19–50), inhaltlicher Grundlegung (53–156) und praktischen Konsequenzen (159–254).
Komposition und interdisziplinärer Zugriff verdeutlichen, dass es in der Kontroverse über die Bibelübersetzungen um eine, allerdings zentrale Konkretion einer allgemeinen und auch in anderen Bereichen begegnenden Auseinandersetzung geht. Es stellt sich hier wie auch sonst die Frage nach dem Verbindlichen, Vorgängigen, Bleibenden, Universalen, nach Wahrheit und Authentizität in Erkenntnis und Lebensführung. Der vielen Entwicklungen in Gesellschaft, aber auch Theologie zugrundeliegende Ansatz bestreitet die Legitimität dieser Frage und plädiert für einen individualistischen und – vermeintlich – pluralistischen Zugriff auf die Wahrheit. Felbers Sammelband befragt diesen Ansatz auf seine sachliche Angemessenheit sowie Stimmigkeit. Die besondere Relevanz des Konflikts in seiner Auswirkung auf die Bibelübersetzung wird deutlich, da mit dem Zusammenhang von Sprache, Inhalt und Person Christi bei der Bibel die Heilsfrage im Raum steht (105f).
Als Beispiel für „Sprachumweltverschmutzungen“ (10) wird erstens die immer breitere Anwendung der sog. „leichten Sprache“ genannt, die ursprünglich für Behinderte und Migranten gedacht war, jetzt aber zu einer allgemeinen Verflachung und inhaltlichen Reduktion der Sprache führt (19f). Zweitens setzt sich in der Belletristik immer mehr eine „Plauderlyrik“ durch, bei der es um ein Selbstzeugnis der Autoren ohne Unterschied von Alltags- und Literatursprache geht (24f). Ein Schriftsteller mit traditionellem Berufsverständnis muss sich am damit einhergehenden Verlust sinnlich-ästhetischer Erfahrung stören (25f).
Scharfsinnig weist Werner Creutziger auf einen Selbstwiderspruch des gängigen Sprachgebrauchs hin. Der weitgehende Verzicht auf Regeln und Qualitätsstandards für Sprache wird zwar mit der Wahrung demokratischer Vielfalt begründet. Tatsächlich führe die mangelnde Spracherziehung aber zu einem Verlust an Sprachmündigkeit und Diskursfähigkeit breiter Bevölkerungskreise und zur Stabilisierung der Herrschaft sozialer Eliten (28–33). Die Menschen würden gerade nicht dort abgeholt, wo sie stehen, sondern zu dialogunfähigen Empfängern interessengeleiteter Botschaften der Bildungselite (27f). Die „Regellosigkeit“ (45) und das lose Nebeneinander von Formulierungen hängt mit dem Vorrang der Beschreibung (Deskription) vor der Vorschrift (Präskription) zusammen (41). Harald Seubert stellt dann heraus, wie aus vermeintlicher Herrschaftslosigkeit tatsächlich neue Postulate entstehen. So werde erstens der „Befund von Pluralität … zur einzigen verbliebenen Normativität des Pluralismus“ (144). Zweitens führe der Verzicht auf einen allen Beteiligten vorgegebenen Bezugspunkt zu einem Recht des Stärkeren, spürbar etwa in der „Übermoralisierung des Politischen“ (146). Felber weist auf Nietzsche hin, für den Sprache „keinen Anhalt mehr an der Wirklichkeit“ hat. In der Kommunikation gehe es dann nur noch um ein Ringen zwischen Interpretationen und um Sprachpolitik unter dem Vorzeichen von political correctness und gender mainstreaming (113).
Die beschriebenen Indizien von Verwahrlosung, aber auch Zweckentfremdung von Sprache finden sich Felber zufolge mit Modifikationen auch in neueren Bibelübersetzungen, wobei v. a. die „Gute Nachricht“ und die „Hoffnung für alle“ im Blick sind. Ähnlich wie die Rezeption der Sozialwissenschaften in der Praktischen Theologie und die der Philosophie in der Systematischen Theologie mit einer grundlegenden Wesensveränderung dieser Disziplinen einhergeht, sieht Felber eine Problematik im Bereich der Bibelübersetzung. Den dynamisch-äquivalenten Übersetzungen liegt die Sprachtheorie des Linguisten Eugene E. Nida (1914–2011) zugrunde. Dem Selbstanspruch nach handele es sich bei Nida um eine wissenschaftliche Herangehensweise. Felber bezweifelt dies, wenn philologische Genauigkeit für weniger wichtig erachtet wird als die intellektuelle Verständlichkeit oder inhaltliche Akzeptierbarkeit für den Leser (85, 67). Die Übersetzung der Bibel werde ohne Rücksicht auf die Besonderheit der Bibel als Anwendungsfall allgemeiner Übersetzungstheorien behandelt, so dass die „Standards für das Übersetzen der Bibel … nunmehr von außerhalb statt umgekehrt“ kommen (85). Felber interpretiert Nida so, dass sich bei diesem Sprachen nur oberflächlich unterschieden und auf einen gemeinsamen Kern zurückgingen. Wenn jedoch Ausgangs- und Zielsprache lose nebeneinander stehen, ist Nidas Plädoyer für eine Orientierung an der Zielgruppe und deren Verstehensvoraussetzungen bzw. -fähigkeiten folgerichtig (67). Sprache erscheine bei Nida als rein funktionales Informationsmittel (69). Begriffe gelten Nida als veränderbar und austauschbar (75). Mit einigen Beispielen belegt Felber, wie diesem Ansatz verpflichtete Bibelübersetzungen häufig Konkretes zu Allgemeinem oder Abstraktem verändern, ebenso Handlungen Gottes zu solchen der Menschen machen und die Erfahrung Gottes von seinem Wort lösen (84–90).
Als Gemeinsamkeit der Entwicklungen im allgemeinen Sprachgebrauch und in den modernen Bibelübersetzungen zeigt sich der fehlende Rückbezug auf eine übergeordnete Wirklichkeit. Felber verdeutlicht mit Beispielen aus der Bibel und aus Luthers Ausführungen zur Bibelübersetzung, dass es sich bei der Bibel um ein Dokument mit wesensspezifischer Eigenart, um ein „Sprachmysterium“ (112) handelt, was eine Anwendung allgemeiner, von diesem Wesen absehender Methoden für die Übersetzung verbietet (184).
Das Wort Gottes zeichne sich durch den Zusammenhang von Geist und Buchstabe, von Gehalt und Gestalt, von Aussage und Wirkung aus (76–81, 85). „Gottes Wort ist nicht nur Ankündigung oder Information. Es schafft Wirklichkeit“ (73). Felber stellt die Bedeutung der Bibel – und zwar in ihrem Wortlaut – als „Heilsmittel“ (82, 86f, 114f) heraus, die etwa durch die Einsetzungsworte beim Abendmahl „eine neue Situation“ schafft (74). Die Bewegungsrichtung verläuft Felber zufolge stets vom Wort Gottes zum Leser bzw. Hörer. Wie das Sämann-Gleichnis zeige, liege das Problem mangelnder Wirkung nicht am Wort Gottes, so dass der Übersetzer hier nachhelfen müsse. Vielmehr zeige sich „an der Reaktion auf dieses Wort … die Qualität des Bodens – nicht die Qualität des Wortes am Boden!“ (91). Felber betont unter Rekurs auf Luther, dass es bei der Wirkung der Bibel um einen geistlichen, von Gott ausgehenden, und erst von dorther um einen hermeneutischen Vorgang gehe. Das Verstehen der Bibel kann nicht einfach durch didaktische Mittel herbeigeführt werden. So sollten die Gleichnisse Jesu nicht der „intellektuelle[n] Hörerschwäche“ aufhelfen, sondern zielten auf die Scheidung zwischen Verstehenden und Nichtverstehenden, weil die menschlichen Gedanken durch die göttlichen durchkreuzt würden (90, vgl. Mt 13,14f). Im Gegensatz zu Nida hält Felber an der Autorität der Bibel und an der Normativität des ursprachlichen Ausgangstextes auch für den Fall fest, „wo die Möglichkeit von Mißverständnis und Ablehnung droht“ (94, 112). Der literarische Stil des Neuen Testaments genügte vielfach gerade nicht den Qualitätsmaßstäben antiker Klassiker, wurde von gebildeten Zeitgenossen verachtet, entsprach aber genau in dieser Form dem Geschehen und der Person, von dem und die durch die Bibel handelt. Luther übersetzte Begriffe wie „Evangelium“ bewusst nicht, um die Fremdheit und Unverfügbarkeit des Wortes Gottes zu erhalten (110, 182).
Daraus folgt für Felber, dass prioritär nicht die Bibel an den Sprachgebrauch der jeweiligen Gegenwart angepasst werden muss, sondern umgekehrt müsse man die „Worte der Zielsprache in die Taufe nehmen“ (92, vgl. 43, 102f). Mit dem Vorrang der Ausgangssprache – gerade auch in ihrer punktuellen Fremdheit – sieht Felber eine Korrektivwirkung gegeben, die für die Bibel als veränderndes Heilsmittel konstitutiv ist. In „der Bejahung … bibelgeprägten Sprechens, des Eigenrechts, des normativen und korrigierenden Stellenwertes biblischer Begriffe“ finde man eine Sprachform, die „Gott angemessen“ bzw. „der Würde, Heiligkeit und Eigentümlichkeit des göttlichen Redens angemessen“ sei (185, 189). Die Sachgemäßheit als Angemessenheit hinsichtlich des Wesens des Wortes Gottes sollte demnach das primäre Kriterium bei der Ausarbeitung von Bibelübersetzungen sein.
Konsequenterweise fordert Felber in den praktischen Anwendungen ein „Moratorium“ für neue Bibelübersetzungen (222, 232f). Um die Wirkung des Wortes Gottes in authentischer Form zur Entfaltung zu bringen, tritt Felber für das Auswendiglernen und Rezitieren der Lutherbibel sowie – nach dem Vorbild der King James Version – für gute Studienbibeln und Lesehilfen für die Lutherübersetzung ein (69, 190f). Obwohl auch die Elberfelder Bibel und Schlachters Übersetzung nahe am Ausgangstext liegen, priorisiert Felber die Lutherbibel, weil sie besser memorierbar sei und eine zuverlässige sowie einheitliche Zitierfähigkeit der Bibel anzustreben sei (189–192). Man wird freilich fragen müssen, ob die Lutherbibel von katholischen und freikirchlichen Christen nicht als zu stark konfessionell geprägt wahrgenommen wird, um eine für alle deutschsprachigen Christen verbindliche Bedeutung zu erhalten. Dabei hat Luther selbst bis zur „Ausgabe letzter Hand“ von 1545 immer wieder an seiner Übersetzung gefeilt, haben die Drucker der Lutherbibel sein Deutsch an die jeweiligen regionalen Mundarten angepasst und später nicht mehr gebräuchliche Worte ausgetauscht. Hinzu kamen die kirchenamtlichen Revisionen der Lutherbibel ab 1892. Felber geht es aber wohl weniger um einen in jedem Detail sich durchhaltenden Wortlaut als um das sozusagen Atmosphärische der Lutherübersetzung.
Auf philosophische Weise unterstützt Harald Seubert die Anliegen Felbers. Dabei hält Seubert den Ansatz Nidas für nominalistisch, weil zwischen dem Bezeichneten und Bezeichnendem keine Wesensverwandtschaft gesehen werde (151). Nida vertrete ein „technisches, funktionales Sprachverständnis“ (135).
Lohnenswert wäre, die wertvollen Untersuchungen des Sammelbandes zu ergänzen im Hinblick auf die zum eigentlichen Bibeltext hinzukommenden Zusätze textlicher und bildlicher Art in der Geschichte der Bibelausgaben. Auch bei der Lutherbibel 2017 weisen gerade die Zusätze viele Probleme auf. Die von Felber kritisierten, jedoch auch von Evangelikalen gelesenen Bibelausgaben kämen etwas besser weg, wenn als Vergleichspunkt z. B. die sog. „Bibel in gerechter Sprache“ gewählt würde. Bei dieser droht aus der Ausrichtung auf die Zielsprache die politisierende Vereinnahmung durch bestimmte Zielgruppen im Sinne von Interessengruppen zu werden.
Dr. Christian Herrmann, Bibliotheksdirektor und Leiter der Historischen Sammlungen, Württembergische Landesbibliothek Stuttgart