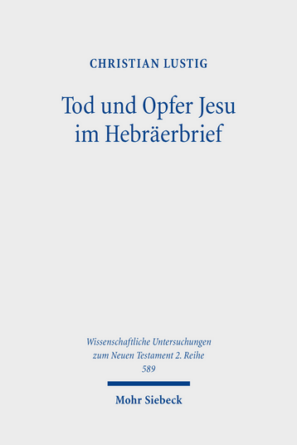Christian Lustig: Tod und Opfer Jesu im Hebräerbrief
Christian Lustig: Tod und Opfer Jesu im Hebräerbrief, WUNT II/589, Tübingen: Mohr Siebeck, 2023, geb., XII+304 S., € 99,–, ISBN 978-3-16-162128-4
Das vorliegende Buch stellt die leicht revidierte Fassung einer Doktorarbeit dar, die von Wolfgang Kraus an der Universität des Saarlandes betreut und mit welcher der Verfasser dort im Frühjahr 2022 promoviert wurde. Inhaltlich geht es um die „Frage …, welche Bedeutung der Tod Jesu für den Autor des Hebräerbriefs hat“ (2). Die Antwort wird in drei Teilen entfaltet.
Im unter der Überschrift „Jesu Tod und Unvergänglichkeit“ stehenden Teil A (5–75) werden zunächst die – wenigen – Stellen des Hebräerbriefes vorgestellt, in denen es um Jesu Tod bzw. Sterben geht (Hebr 2,9.14; 5,7; 6,6; 9,15–17; 9,27–28; 12,2; 13,20). Hierzu betont Lustig: „Dass im gesamten Traktat … nie explizit von Jesu eigenem Tod gesprochen wird, und dass man ebenso die verbale Aussage, Jesus sei gestorben, vergeblich sucht, ist … bemerkenswert“ (16).
In einem nächsten Schritt wird die in Hebr 7 anzutreffende Lehre von Jesu Unvergänglichkeit behandelt. Diese steht zu seinem Tode auf den ersten Blick zwar in einem gewissen Widerspruch, welcher von Lustig aber mit dem Hinweis auf Jesu unsterbliches πνεῦμα aufgelöst werden kann. Es wird deutlich, „dass es für Jesus, wie auch für den Menschen, einen organischen Tod gibt, der aber das Leben nicht in einem ganzheitlichen Sinn beendet … Infolgedessen kann der im Hebräerbrief (vorsichtig) erwähnte Tod Jesu nur als ein bloß physisches Ableben der Person verstanden werden“ (74).
Hiermit erklärt Lustig zudem seine Beobachtung, im Hebräerbrief sei nirgends von Jesu Auferstehung bzw. Auferweckung die Rede (74). Ob dies so zutreffend ist, darf m. E. jedoch bezweifelt werden. Im Vorübergehen (d. h. lediglich in Anm. 76) und ohne jegliche exegetische Beweisführung verneint Lustig im Hinblick auf Hebr 11,17–19 die (doch durchaus bestehende) Möglichkeit, die Bindung Isaaks (auch) als Hinweis auf den Opfertod und die Auferstehung Jesu aufzufassen (vgl. Hebr 13,20; Barn 7,3).
Der lange Teil B (77–252) trägt den Titel „Die Heilsbedeutung des Todes Jesu“ und ist das Herzstück der Monografie. In einem forschungsgeschichtlichen Überblick skizziert Lustig die ältere, aber neuerdings (etwa in den Arbeiten von Georg Gäbel, David Moffitt und Benjamin Ribbens) wiederauflebende Auslegung, „Kreuzestod und himmlische Darbringung voneinander zu trennen und das eigentliche Opfer an das himmlische Heiligtum zu binden“ (78). Daraus ergibt sich für Lustig die „Frage, wie sich im Hebräerbrief der Tod Jesu und sein Opfer zueinander verhalten“ (87).
Bei deren Beantwortung geht Lustig von vorne bis hinten durch den Brief, wobei er (ähnlich wie viele andere Neutestamentler) das ganze Kapitel 13 (also auch Hebr 13,20!) für sekundär hält (251). In Bezug auf Hebr 1–12 ergibt sich für ihn folgendes Bild: Zu Beginn wird im Brief grundlegend herausgestellt, dass Jesu Tod heilseffizient ist (Hebr 2,9.14–15). Dies gilt dann auch für die erst im Anschluss einsetzende Hohepriesterchristologie (Hebr 2,17; 9,15–16.27–28). „[E]ine materiell gedachte Blutapplikation im himmlischen Heiligtum (etwa Hebr 9,12; 9,23)“ kommt, so Lustig, für den Autor des Hebräerbriefes nicht infrage (166). Als Ergebnis hält Lustig vielmehr fest, „dass der Tod Jesu Christi selbst für den Autor … das eine entscheidende Heilsereignis gewesen sein muss“ (238).
Während David Moffitt in Bezug auf das von Jesus bewirkte Heil von der chronologischen Reihenfolge „Tod, Auferstehung, Eintritt ins himmlische Heiligtum und dann dort die Blutapplikation zur Sündenvergebung“ ausgeht (192), entwirft Lustig im sehr kurzen Teil C seiner Monografie (253–264) ein völlig anderes Szenario, das bereits in der Überschrift „Irdisches Opfer in himmlischem Heiligtum“ angedeutet wird: „Christus wird hinsichtlich seines Priesteramtes nach melchisedekischer Ordnung als unvergänglich, lebendig und ewig bezeichnet. Bei seinem physischen Tod stirbt sein πνεῦμα nicht, sondern er bringt sich selbst gerade kraft des ewigen πνεῦμα dar. Das πνεῦμα, das zu den ἐπουράνια gehört, schafft dabei die Beziehung zum himmlischen Heiligtum. Physisch befindet sich Jesus auf Erden, der Geist betritt im Opfer das Heiligtum. Als Opfermaterial benennt AuctHebr [Auctor ad Hebraeos] unmissverständlich Jesu Blut und Leib“ (262). Diese Sicht der Dinge ist jedoch nicht (völlig) neu, sondern wurde, worauf Lustig auch deutlich hinweist, bereits von Franz Laub angedacht (78).
Von Lustig wird eingangs zwar zu Recht betont, dass sich der Autor des Hebräerbriefes „dezidiert gegen eine spiritualisierte oder ethisierende Auslegung des Opfers [wendet], denn ohne Blutvergießen gibt es für ihn keine Sündenwegnahme (Hebr 9,22)“ (4). Dennoch hätte die „intérpretation non-sacrificielle“ bzw. sogar „radicalement anti-sacrificielle“, die François Vouga am Hebräerbrief vornimmt, zumindest erwähnt bzw. kurz diskutiert werden können.
Nach der Bündelung der im Großen und Ganzen überzeugenden Ergebnisse (Teil D; 265–268) wird das lehrreiche, logisch aufgebaute und sorgfältig aufgemachte Buch durch ein Literaturverzeichnis (269–285) sowie durch Autoren- (287–288), Stellen- (289–299) und Sachregister (300–302: deutsch; 303–304: griechisch) abgerundet.
Es ist überaus erfreulich, zu dem für den christlichen Glauben so zentralen Thema „Tod und Opfer Jesu“ nun diese gründliche biblische Studie zur Verfügung haben zu dürfen.
Dr. Boris Paschke, Guest Associate Professor of New Testament, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgien