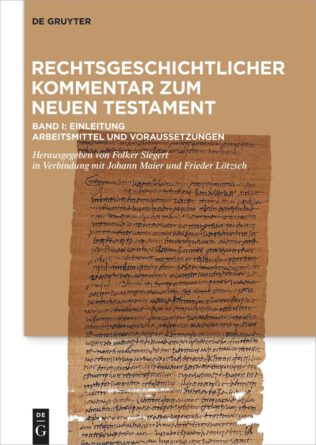Folker Siegert (Hg.): Rechtsgeschichtlicher Kommentar zum Neuen Testament
Folker Siegert (Hg.): Rechtsgeschichtlicher Kommentar zum Neuen Testament. Band I: Einleitung. Arbeitsmittel und Voraussetzungen, Berlin: De Gruyter, 2023, geb., XIII+720 S., € 140,14, ISBN 978-3-11-065606-0
Der Rechtsgeschichtliche Kommentar zum Neuen (RKNT) will „Rechtsfragen und Rechtsgüter des Neuen Testaments genauer […] benennen, u.z. auf dem Hintergrund der sie definierenden Rechtsordnungen“ (https://rknt.uni-muenster.de/dasprojekt.php). Das Projekt begann mit einem Autorenkolloquium in Münster im Juni 2005. Der erste Band ist 2023 erschienen, der nächste Band ist für 2024 angekündigt.
Der von Volker Siegert (Institutum Judaicum Delitzschianum, Münster) herausgegebene erste Band ist in drei Teile gegliedert. Teil A (3–122; Folker Siegert) behandelt in sechs Kapiteln das Anliegen des Kommentars, eine Einführung in den Begriff des Rechts und in die Charakteristika des römischen Rechts, die Jurisprudenz der protestantischen Barockjuristen (Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Christian Wolff) sowie die Vorarbeiten und den Aufbau des Kommentars. Der Rechtsbegründung aus dem Naturrecht anstatt aus der Bibel, wie sie Grotius, Pufendorf und andere beschrieben (77–84, sowie 435–443, 478–484, 627–628), wird von Siegert eine weitreichende Bedeutung für den Kommentar zugeschrieben (6).
Teil B (125–267) behandelt in sechs Kapiteln die Verfassungsgeschichte Judäas und die Quellen des jüdischen Rechts (Einführung und bibliographische Übersicht; Johann Maier), die Papyri aus der Wüste Juda (Siegert) und die römischen Rechtsquellen in Übersicht (Martin Schermaier); am Ende steht ein Glossar der wichtigsten Fachausdrücke (Siegert).
Teil C (271–465) behandelt übergreifende Themen: „Buchstabe und Geist in jüdischem und römischem Recht“ (Boaz Cohen); „Schwören im Recht des antiken Judentums“ (Maier); „Witwen und Waisen in Judentum und Christentum“ (Ulrich Kellermann); „Bibel und Recht. Ein Durchgang vom Dekalog bis zur Gegenwart“ (Siegert). Es bleibt unklar, weshalb gerade diese vier Themen ausgewählt wurden. Während das erste und das vierte Thema allgemeiner Natur sind und sich als „übergreifende“ Themen eignen, ist das zweite und dritte Thema konkret, was die Frage veranlasst, weshalb nicht auch Themen wie Gesetz und Sitte, Wille und Verantwortung, Eigentum und Besitz, Schuldigkeiten und Forderungen, Schenkung und Zins, Botenrecht und Vollmacht, Freiheit und Sklaverei, Bürger und Bürgerrecht, Eherecht und Sexualvorschriften, Familie und Vereine, Regierung und Verwaltung, Steuern und Besatzungsrecht, Gerichtswesen und Prozessrecht, Kalender und Feiertage behandelt werden – alles Themen, die in der Liste der Rechtsthemen (699–720) aufgeführt werden.
Es folgen siebzehn von F. Siegert verfasste Exkurse (467–626) zu Themen wie Gesetz und Evangelium, Bibel und Geschichte, kosmisches und menschliches Naturrecht, der Begriff der Evidenz, Leibnitz’ Kritik an Pufendorf, Theologie und Jurisprudenz. Nach einer Konkordanztabelle zu Pufendorf’s Eris Scandica findet man Zitierkonventionen und Transkriptionsregeln, ein Abkürzungsverzeichnis, ein Literaturverzeichnis (641–688), und Listen der behandelten Perikopen in den Bänden II–VI (insgesamt 395 Perikopen) sowie der Rechtsthemen.
Unter der Überschrift „Vorarbeiten“ behandelt Siegert zunächst die „Sichtung der Quellen. Einleitungswissenschaft“ (85–99) im Anschluss an eigene Arbeiten zu diversen Einleitungsfragen, deren Ergebnisse offenkundig als Grundlage des RKNT gelten sollen. Zu der postulierten Phase A gehören die Quellen der Synoptiker (vor allem die Logienquelle und nichtsynoptisches vorjohanneisches Traditionsgut im Johannesevangelium), die als echt akzeptierten Paulusbriefe, der Hebräerbrief, und das Markusevangelium. Der Phase B werden die Evangelien des Lukas und Matthäus sowie die „unechten“ Briefe an die Kolosser und Epheser und der erste Petrusbrief zugewiesen, ebenfalls die „Montage“ des 2Kor; für diese Phase wird auch der erste anzunehmende Gesamtwurf des Johannesevangeliums als noch nicht edierter Text angenommen, sowie 2Joh und 3Joh. In der Phase C wird das Johannesevangelium, 1Joh, die Johannesapokalypse (Zeit Hadrians), sowie 2Thess, 1Tim, 2Tim, und Titus angesetzt. Die „pseudepigraphen“ Briefe der Brüder Jesu – Jakobus und Judas – sind entweder der Phase B oder C zuzuordnen. Siegert meint, das in Phase A Gesagte sei „jedenfalls ernst zu nehmen, außer wo es allzu deutlich den Eindruck des Konstruierten macht (so im Mk das Itinerar Jesu und die erste Phase des Prozesses Jesu, Mk 14)“, während das in Phase B gesagte „meist Kommentarcharakter“ hat und die Phase C „Streitigkeiten“ bezeugt (97). Alternative Bewertungen der Einleitungsfragen werden ausgeblendet, was Siegerts „Vorarbeiten“ einen einseitigen ideologischen Anstrich gibt. Was etwa Rainer Riesner und Richard Bauckham zu den Evangelien und Craig Keener und Armin Baum zur Apostelgeschichte und zur Frage der Pseudepigraphie geschrieben haben – um nur einige wenige Forscher zu erwähnen, die gegen die von Siegert postulierten Positionen argumentieren – kann man nur mutwillig (im buchstäblichen Sinn des Wortes) ignorieren. Siegert hat sicher Recht wenn er feststellt: „Die hier [d. h. im RKNT] untersuchten Texte waren alle einmal klarer, als sie es heute sind; sie hatten Leser und Hörer, die die Verhältnisse kannten, besser als wir“ (5). Dies trifft m. E. auch auf die Entstehungsbedingungen der neutestamentlichen Texte zu: ein Dokument „Q“ ist hypothetisch konstruiert und nirgends als existierender Text nachgewiesen; die Evangelien wurden in den Gemeinden als Bücher gelesen, die von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes verfasst wurden; die Pastoralbriefe sowie Kol, Eph, und 2Thess wurden als Paulusbriefe kopiert und gelesen. Wenn der RKNT „die sog. Realien des Neuen Testaments“ darstellen und „von freien Erfindungen der erzählenden Phantasie oder von den unhistorischen Annahmen seitheriger Übersetzer“ unterscheiden will (5), dann sollte man den RKNT nicht von der literargeschichtlichen Phantasie einiger Neutestamentler abhängig machen, sondern die „Realien“ der textlichen Bezeugung der Autorschaft der neutestamentlichen Texte ernst nehmen, die von den leitenden Theologen und Autoren des späten ersten Jahrhunderts sowie des zweiten und dritten Jahrhunderts akzeptiert wurden. Wir warten auf die folgenden Bände des RKNT, um bewerten zu können, ob und wie die Position Siegerts in den Einleitungsfragen die Behandlungen neutestamentlicher Stellen beeinflusst, gleichfalls, in welchem Maße der Rechtsansatz von Grotius, Pufendorf und Wolff aus dem 17. Jahrhundert angewandt wird.
Der erste Band des RKNT weckt jedenfalls die Erwartung, dass die nächsten Bände vieles Relevante über die „Realien“ der neutestamentlichen Texte bieten werden.
Prof Dr.Eckhard J. Schnabel, Gordon-Conwell Theological Seminary