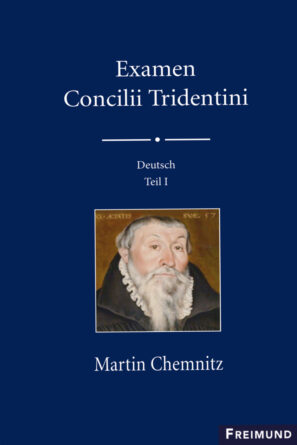Martin Chemnitz: Examen Concilii Tridentini nach der deutschen Übersetzung (1576) des Georg Nigrius bearb. durch Martin Hamel (Hg.)
Martin Chemnitz: Examen Concilii Tridentini nach der deutschen Übersetzung (1576) des Georg Nigrius bearb. durch Martin Hamel (Hg.), Bibliothek lutherischer Klassiker 4, Teilbände 1–4, Neuendettelsau: Freimund, 2022, geb., 3.168 S., € 139,–, ISBN 978-3-946083-73-3
Die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung von Martin Chemnitz’ (1522–1586) Examen Concilii Tridentini im kleinen lutherischen Freimund-Verlag in Neuendettelsau stellt einen außerordentlichen Kraftakt dar, man kann sagen: Eine Sensation!
Die umfangreiche Originalausgabe (EA 1565–1573) wurde von Fachtheologen gelesen und deshalb im 16. und 17. Jahrhundert auf Lateinisch mehrfach nachgedruckt. – Heute wird das lateinische Examen nach der Ausgabe zitiert, die Eduard Preuss nach den Auflagen von 1578 und 1707 in Berlin 1861 (Verl. Gustav Schlawitz) neu veranstaltet hat. Diese Neuausgabe in einem Band wurde 1915 in Leipzig (Hinrichs’sche Buchhandlung), 1972 in Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) und in den letzten Jahren bei W. de Gruyter Berlin nachgedruckt (2021, als E-Book und mit Online-Zugang 2023: https://doi.org/10.1515/9783112491720; auch bei Google books).
Eine deutschsprachige Übersetzung des monumentalen Werkes durch den Gießener Pfarrer Georg Nigrinus (1530–1602) erschien schon 1576. Sie wurde aber seither nicht mehr neu aufgelegt. Wahrscheinlich war die Zielgruppe der deutschen Ausgabe zu klein. So fand sie bisher nur die Aufmerksamkeit von Experten. Eine deutschsprachige Auswahlausgabe durch den Cloditzer Diakonus Rudolf Bendixen (Leipzig 1884) wurde von einem der seinerzeit führenden lutherischen Theologen, dem Leipziger Ordinarius Christoph Ernst Luthardt, lobend begleitet und mit einem Vorwort bedacht. Das Opus magnum von Chemnitz sei wertvoll für die Apologetik. Es stehe „unter den klassischen Werken der theologischen Literatur unserer Kirche […] in erster Linie“, enthalte allerdings mannigfach historisches Material, das „für unsere Zeit seine Bedeutung mehr oder minder verloren hat“ (III, unpag.). Doch sei die Zusammenfassung durch Bendixen am Ende des 19. Jahrhunderts doppelt bedeutsam, weil der römische Katholizismus wieder offensiv vorangehe und Chemnitz die Stärke der evangelischen Position klar herausarbeite (IV).
Nun hat sich der Bad Salzuflener Ruheständler Pfarrer Dr. Martin Hamel der außerordentlichen Anstrengung unterzogen, die komplette Übersetzung des Examens durch Nigrinus zu erfassen, mit dem lateinischen Original zu vergleichen und sie mit erläuternden historischen und weiterführenden themenbezogenen Anmerkungen und Ergänzungen herauszugeben. Die Neuedition zum 500. Geburtstag von Martin Chemnitz im Jahr 2022 ist ein würdiger Beitrag zum Gedenken an diesen hochgebildeten Braunschweiger Gelehrten. Zugleich macht es zurecht den nicht weniger klugen hessischen Theologen (Lebensstationen u. a. Homberg/Ohm, Gießen, Superintendent in Alsfeld und Nidda) bekannt, der vor fast 450 Jahren den Text übersetzte und publizierte.
Heute beherrschen nur wenige Theologen die lateinische Sprache so sicher, dass sie sich in einem lateinischen Fachbuch so gut wie in einem deutschen Text orientieren können. Wir leben in lateinarmen Zeiten – die Lage wird sich wahrscheinlich nicht verbessern. Daher hat die deutschsprachige Ausgabe des „Examens“ einen bleibenden Wert für das Studium von Quellentexten aus der Zeit der Gegenreformation und der Frühorthodoxie.
Der erste Teilband des „Examens“ (Bibliothek lutherischer Klassiker 4,1) behandelt in zehn Loci die Grundlagen von Lehre und Praxis der römisch-katholischen Kirche in Hl. Schrift und Tradition sowie die zentralen Themen Sünde und Erlösung. Wenn man von den biblischen Aussagen allein ausgeht, könnten diese römisch-katholischen Lehren nicht begründet werden. Die zehn Abschnitte lauten: Von der heiligen Schrift; Von den Traditionen; Von der Erbsünde; Von der (nach der Taufe im Gläubigen) übrigen Erbsünde; Maria ohne Erbsünde; Werke der Ungläubigen; Vom freien Willen; Von der Rechtfertigung; Vom Glauben; Von guten Werken (1,76–770).
Im besonders umfangreichen zweiten Band (2,11–902) beschäftigt sich Chemnitz in vierzehn Lehrpunkten mit der tridentinischen Sakramentenlehre. Sie erweitere das biblische Zeugnis durch zahllose Traditionen und mache es dadurch unsichtbar. Teilthemen sind hier: Von den Sakramenten; Von der Taufe; Von der Firmung; Vom Sakrament der Eucharistie; Von der Kommunion unter beiderlei Gestalt; Von der Messe; Von der Buße; Von der Reue; Von der Beichte; Von der Absolution; Von der Notwendigkeit und Frucht der Genugtuung; Von der letzten Ölung; Vom Sakrament der Ordinierung oder der Weihe; Vom Ehestand.
Mit den Loci des dritten und vierten Bandes sieht Martin Chemnitz massive Irrtümer der Papstkirche angesprochen (vgl. ausführlich 3,50), in Band 3: Keuschheit, Zölibat und Jungfrauschaft; Zölibat der Priester; Vom Fegfeuer; Anrufung der Heiligen (3,49–742); in Band 4: Reliquien der Heiligen; Von den Bildern; Vom Ablass; Vom Fasten; Von den Festen (4,48–542).
Den Textseiten sind Vorworte und Anhänge beigegeben. Besonders wichtig sind im Anhang des vierten Bandes (4,643–734) das Personenverzeichnis (4,559–601), das Verzeichnis der von Chemnitz zitierten Autoren und Dokumente (4,603–657) und die Übersicht über die behandelten Konzilstexte (4,658–666). Die ausführlichen Inhaltsverzeichnisse im jeweiligen Band, zusammengestellt im vierten (4,692–719), sind eine praktische Hilfe bei der Auffindung von Themen. Weitere historische Vorreden und Anhänge (zum Beispiel der Chemnitz-Lebenslauf des Erlanger Ordinarius im 19. Jh., Heinrich Schmid, 4,543–557) machen die Bände eher unübersichtlich. Mehrere Beiträge und Anmerkungen des Herausgebers weisen interpretatorisch nur in die eine Richtung, dass alle Lehrsätze von Trient heute noch gültig sind und folglich die römisch-katholische Kirche mit Martin Chemnitz in Bausch und Bogen zu verurteilen sei.
Es ist richtig, dass eine Kirche in erster Linie nach den von ihr als grundlegend benannten und gültigen Lehrdokumenten zu beurteilen ist. Doch muss in einem zweiten Durchgang auch ermessen werden, inwiefern der Anspruch der in Geltung stehenden Lehre auch eingelöst wird. Es ist ein Unterschied, ob ein in evangelischem Sinn Gläubiger in seinem Glauben leben, ihn weitersagen und im Gemeindeleben einbringen, ja damit sogar Bischof von Passau werden kann oder ob er so schnell wie möglich festgenommen und auf den Scheiterhaufen gebracht wird. Wenn Lehrcorpora der Vergangenheit so „unangetastet“ in Geltung bleiben, dass sie kaum noch bekannt sind und weder positiv-leitende noch negativ-strafende Wirkung entfalten, sind sie dann nicht de facto ungültig? (Diese Frage stellte sich auch der Bekennenden Kirche in der Reichskirche während des Dritten Reichs.) Die konziliaren Bemühungen um Aggiornamento lassen im römischen Katholizismus einen breiten Spielraum für neue Arbeitsformen und Modernisierungsbemühungen. Erneuerungsbewegungen lässt die katholische Weltkirche nicht nur leben, sondern bringt ihnen auch Wertschätzung entgegen; „evangelische“ Katholiken werden geduldet oder gebilligt.
Für die katholische Lehrbildung ist es typisch, dass sie sich nicht auf ein bestimmtes normatives Dokument beschränkt – im Gegensatz zur evangelischen, die sich in Lehrfragen seit der Reformationszeit auf die unica norma et regula der Bibel beruft. Besonders das Zweiten Vatikanische Konzil hat katholischerseits dem Tridentinum Texte zur Seite gestellt, die ihm klar widersprechen, aber ohne es aufzuheben.
So heißt es in §55 der Konstitution über die Heilige Liturgie vom 4.12.1963 über die Eucharistie mit Brot und Wein: „Unbeschadet der durch das Konzil von Trient festgelegten dogmatischen Prinzipien kann in Fällen, die vom Apostolischen Stuhl zu umschreiben sind, nach Ermessen der Bischöfe sowohl Klerikern und Ordensleuten wie auch Laien die Kommunion unter beiden Gestalten gewährt werden …“. Damit wird auch die eigentliche Lehrnorm der katholischen Kirche jenseits von Bibel und Tradition bzw. Kirchenväterlehren und Synodalentscheidungen benannt: Der „Apostolische Stuhl“, die oberste Lehrautorität des Bischofs von Rom, der zugleich letztgültig Lehrer der weltweiten Kirche ist.
Die römisch-katholische Kirche hat also seit dem Konzil von Trient in Lehre und Leben eine beachtliche Entwicklung erlebt (s. o. die Äußerung von Luthardt), die man bei aller Widersprüchlichkeit der Ergebnisse als ebenso geltend oder zumindest als „von oben“ gebilligt wahrnehmen muss wie die tridentinischen Lehrdefinitionen.
Für pietistische Leser wird außerdem wichtig sein, auf Speners sechs Vorschläge zur Kirchenreform in den Pia Desideria (1675) hinzuweisen. Spener empfiehlt ein friedliches Vorgehen und herzliche Liebe gegenüber den anderen Kirchen; streitsüchtiges Disputieren könne „nicht das einzige Mittel der Erhaltung der Wahrheit sein, sondern erfordert andere neben sich“ (Ausg. von Kurt Aland, KlT 170, 62–67, Ratschlag 4).
Diese Buchbesprechung kann auf begrenztem Raum nur einen Eindruck von dem umfangreichen Werk, das Martin Chemnitz geschaffen hat, geben. Dass es sich bei dieser Edition nicht um eine kritische Ausgabe handelt, wird durch den bekannten Sachverhalt relativiert, dass für wissenschaftliche Zwecke auf alle Fälle die Ausgabe von Preuß herangezogen werden muss. Dennoch wird das von der Lutheran Heritage Foundation bezuschusste gewaltige Werk unter Pfarrern, Studierenden und Professoren seine Leser finden, vgl. das oben zu Lateinkenntnissen Gesagte. Dem Freimund-Verlag sei für dieses außerordentliche, wagemutige Editionsprojekt gedankt!
Pfarrer Dr. Jochen Eber, Schriesheim