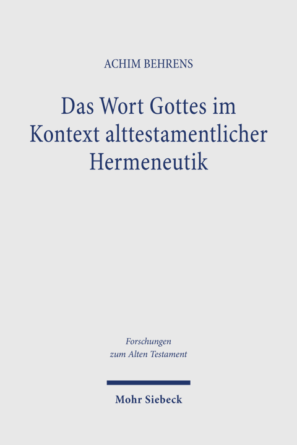Achim Behrens: Das Wort Gottes im Kontext alttestamentlicher Hermeneutik
Achim Behrens: Das Wort Gottes im Kontext alttestamentlicher Hermeneutik. Untersuchungen zum Wort Gottes und zum Gottesbild im Alten Testament, FAT 166, Tübingen: Mohr Siebeck, 2023, geb., XII+402 S., € 154,–, ISBN 978-3-16-162246-5
Denjenigen, die an hermeneutischen Fragen im Bereich des Alten Testaments arbeiten, ist Achim Behrens (B.) vielleicht schon durch sein ausgezeichnetes Lehrbuch Das Alte Testament verstehen. Die Hermeneutik des ersten Teils der christlichen Bibel (Göttingen 2013) bekannt. Nun hat B., seit 2006 Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, seine Habilitationsschrift veröffentlicht, die an der Universität Bern unter der Begleitung von Andreas Wagner entstanden ist.
In einer knappen Einleitung formuliert B. zunächst eine grundsätzliche Fragestellung, die das ganze Buch bestimmt, nämlich „wie die Exegese des Alten Testaments ein Teil der Theologie ist und eben nicht ausschließlich der vorderorientalischen Religionsgeschichte“ (5). Im darauffolgenden ersten Kapitel (11-35) geht es dann um „Grundfragen“. Hier macht B. seine konfessionell-lutherische Perspektive transparent, wobei er den Stellenwert der Bibel mit Bezug auf die Konkordienformel von 1577 feststellt (11-12). Doch wie ist „der Charakter der Bibel als Gottes Wort“ angesichts ihrer geschichtlichen Bedingtheiten im 21. Jahrhundert zu bestimmen? Eine Bestimmung durch Eigenschaften wie „Widerspruchsfreiheit“ oder „Irrtumslosigkeit“ lehnt B. ab (16-17). Stattdessen qualifiziere sich die Bibel dadurch als Wort Gottes, dass Menschen durch die Anrede des Wortes in Gesetz und Evangelium getroffen werden (19, 23).
Das zweite Kapitel (37-117) behandelt das Verhältnis von Altem und Neuem Testament. Es geht hier also um das „hermeneutische Problem des Alten Testaments“ und damit um die (keineswegs neue) Frage, wie eine ursprünglich vorchristliche Schriftensammlung Relevanz für den christlichen Glauben besitzen kann. Hier diskutiert B. unterschiedliche Auslegungsansätze, angefangen von der Alten Kirche über Luther, dessen Hermeneutik besonders ausführlich dargestellt wird (51-63), bis zu Ansätzen des 20. und 21. Jahrhunderts. In diesem Kapitel kommen auch „Modelle der Ablehnung des Alten Testaments“ (Marcion, Schleiermacher, von Harnack, Hirsch sowie in diesem Jahrhundert N. Slenczka) zur Sprache, die B. mit guten Gründen kritisiert (64-85). Am produktivsten in diesem Kapitel erscheinen die „Modelle des Zusammendenkens von Altem und Neuem Testament“ (85-113). An dieser Stelle seien nur knapp die Stichworte „Verheißung und Erfüllung“ und „Typologie“ genannt, wobei B. auf einflussreiche Alttestamentler des 20. Jahrhunderts wie Zimmerli, von Rad und Wolff verweist sowie auf neuere Positionen wie die von Preuß, Gunneweg, Kaiser, Oeming u. a. – diese Themen und Positionen sind allerdings ausführlicher im Hauptteil des oben genannten Lehrbuchs dargestellt.
Im kurzen dritten Kapitel (119-136) behandelt B. (noch einmal) die Frage nach dem „Schriftprinzip“. Mit Luther verweist er auf die Formel sola scriptura und auf das, was Christum treibet (120). Das Schriftprinzip sei allerdings in die Krise geraten, einerseits durch eine „fundamentalistische Verhärtung“, die einen formellen Wahrheitsbegriff zugrunde lege, vor allem aber durch die inzwischen allgemein akzeptierte Erkenntnis der historischen Bedingtheit der biblischen Schriften (122). Hier fragt B. zu Recht nach dem bis heute gültigen Stellenwert der Bibel. Dieser ergebe sich durch die Mehrdimensionalität der biblischen Schriften, die sich durch ihre Rezeptions- und Wirkungsgeschichte zeige, sowie durch das (von B. vorausgesetzte, aber nicht eigens plausibilisierte) Textwachstum durch Fortschreibungs- und Überlieferungsprozesse (126). Gerade in letzterem sieht B. ein Indiz dafür, dass die biblischen Texte für die Tradenten einen (heute noch nachvollziehbaren) „Anredecharakter“ besessen hätten. Daraus folge, dass die Suche nach einem existenziellen Aspekt der Texte eine wesentliche Fragestellung der historisch-kritischen Exegese bilde und nicht etwa einen unwissenschaftlicher Zusatz (130-131). Erst im Anschluss an all diese Überlegungen präsentiert B. seine vorrangige Fragestellung: Inwieweit ist den alttestamentlichen Texten – entsprechend den Grundannahmen der christlichen Theologie – ein Selbstverständnis als „Wort Gottes“ eigen (133-136)?
Diese Fragestellung behandelt B. im vierten Kapitel (137-248), dem Hauptteil der Arbeit. Dazu werden Texte untersucht, die den Ausdruck דבר־יהוה enthalten (oder auf andere Art auf das „Wort Gottes“ referenzieren), und zwar in den Prophetenbüchern, im Deuteronomium und im DtrG sowie in Ps 33 und 119; außerdem werden das Verständnis der Tora als דבר sowie der Ausdruck דבר־יהוה am Schluss des hebräischen Kanons (2Chr 36,22-23) behandelt. Die Exegesen in diesem Kapitel sind (vielleicht zu) ausführlich und können hier nicht im Detail wiedergegeben werden. Als grundlegendes Ergebnis lässt sich aber festhalten, was sich vor allem bei der Untersuchung der Prophetenbücher, aber auch in anderen Texten zeige, nämlich dass die vorausgesetzten Fortschreibungsprozesse exilisch-nachexilische Reflexionen über das Wort Gottes darstellen (z. B. 155, 182), so dass die redaktionell zusammengestellten Bücher insgesamt als Gotteswort rezipiert werden können und sollen (163). Immer wieder verweist B. auf intertextuelle Bezüge zwischen den Texten (z. B. 206-207), und insgesamt lasse sich festhalten, dass das Thema des Wortes Gottes „wie eine Art intertextuelles Netz über einer ganzen Reihe von Einzeltexten liegt und diese […] verknüpft“ (249).
Folgerichtig behandelt das sich anschließende fünfte Kapitel (249-267) das Thema „Intertextuelle Kanonizität“. Hier hält B. zunächst grundsätzlich fest, dass „das Erheben intertextueller Bezüge immer auch eine Rezeptionsleistung ist“; andererseits müssen solche Bezüge „mit exegetischen Mitteln plausibel“ gemacht werden (250). Anschließend verweist er auf allseits bekannte redaktionelle Schlüsseltexte, die die drei Teile des hebräischen Kanons miteinander verbinden (Mal 3,22-24; Jos 1,7; Ps 1,2; Dtn 34,10), sowie auf weitere Texte, die ein „messianisches“ intertextuelles Bezugssystem definieren.
Das sechste Kapitel (269-338) bietet eine kleine alttestamentliche Gotteslehre. Ausgangspunkt hierfür ist die Frage, welche Gottesvorstellungen in der zuvor untersuchten Formulierung „Wort Gottes“ mitschwingen. Das Bild des redenden Gottes ist vielfältig, was B. mit dem Konzept der „Aspektive“ deutet, das von E. Brunner-Taut 1990 in die ägyptologische Forschung eingeführt und seitdem in der alttestamentlichen Forschung breit rezipiert wurde. Die Studie wird durch ein zusammenfassendes siebtes Kapitel (339-352) abgeschlossen.
Es handelt sich hier um ein theologisch sehr engagiertes Buch, das breit konzipiert und gleichzeitig inhaltlich dicht ist. Wer sich als Alttestamentler mit hermeneutischen Fragestellungen beschäftigt, wird an dieser gründlichen Studie nicht vorbeikommen. Etwas ärgerlich sind die vielen ausufernden Fußnoten, die zum Teil wichtige Informationen enthalten. Solch ein Stil erschwert die Lektüre unnötigerweise, bildet aber vielleicht ein Symptom der rabies theologicorum, die nur schwer heilbar ist und die oft mit zunehmender Gelehrsamkeit fortschreitet.
Dr. Carsten Ziegert, Professor für Altes Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen.