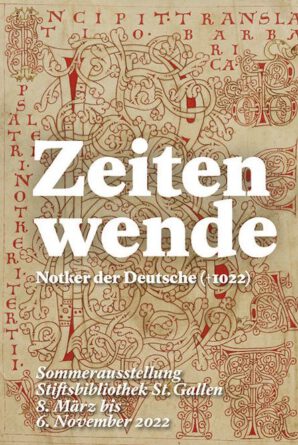Andreas Nievergelt (Hg.): Zeitenwende. Notker der Deutsche (+1022)
Andreas Nievergelt (Hg.): Zeitenwende. Notker der Deutsche (+1022). Sommerausstellung Stiftsbibliothek St. Gallen 8. März bis 6. November 2022, Basel: Schwabe Verlag, 2022, Pb., 112 S., € 25,– , ISBN 978-3-7965-4575-7
Wer heute eine Fremdsprache lernt, sei es Spanisch oder Französisch, weiß das große Angebot an zweisprachigen Lektüre-Ausgaben zu schätzen. Doch was heute als Hilfe für Sprachenlernende selbstverständlich ist, war vor rund 1000 Jahren eine Innovation – und eine Neuheit, über die der Lehrer Rechenschaft ablegen musste. So schreibt Notker der Deutsche, Lehrer und Leiter der Klosterschule St. Gallen, um 1020 in einem Brief an Bischof Hugo von Sitten (Sion, CH-Wallis): „Da ich nun wollte, dass unsere Schüler zu diesen [kirchlichen Büchern] Zugang hätten, wagte ich etwas bis dahin ganz Unerhörtes zu unternehmen. Ich versuchte nämlich, die lateinischen Schriften in unsere Sprache zu übersetzen“ (20). Unterrichtslektüre vom Lateinischen ins Deutsche zu übertragen, das ist eine der herausragenden Leistungen des Mönchs Notker III. (*um 950–1022), der wegen seiner Affinität zur (althoch-)deutschen Sprache auch den Beinamen „der Deutsche“ (Notker Teutonicus) erhielt.
Anlässlich des 1000. Todesjahrs Notkers gab es im Sommer 2022 im Kloster St. Gallen eine Ausstellung zu seinem Werk. Das hier zu besprechende Buch ist der schmale (112 Seiten), aber feine Begleitband zur Ausstellung, mit Beiträgen eines Autorenteams unter Herausgeberschaft von Andreas Nievergelt, Professor für Germanistik an der Universität Zürich und Kurator der Ausstellung. Auch unabhängig von der Ausstellung hat der reich mit Textbeispielen aus den Sankt Galler Handschriften illustrierte Begleitband seinen (Lese-)Wert. Denn hier wird das Werk Notkers des Deutschen, der rund achtzehn Schriften vor allem für die Klosterschule verfasste und unter dessen Leitung die Schule europaweite Bedeutung erlangte, in eindrücklicher Weise vorgestellt.
Als Verfasser des ersten abendländischen Boethius-Kommentars und der ersten Aristoteles-Kommentierung des Mittelalters ist Notker in der Wissenschaft bekannt. Auch dieser Aspekt wird im Buch berücksichtigt. Ins Zentrum gestellt wird hier aber Notker als Lehrer mit seiner zeitgenössisch neuen Lehrmethodik und den dafür von ihm entwickelten und übersetzten Unterrichtsmaterialien. Sein Beitrag zur Bildungsgeschichte im Mittelalter wird neu in dem Blick genommen.
Entsprechend steht – nach dem Vorwort des Stiftsbibliothekars Cornel Dora (6–7) – Notker als „zweisprachiger Gelehrter und Pädagoge mit Herzblut“ (8) im Fokus des einführenden Beitrags von Christine Hehle (8–17). Denn für Notker, Sohn einer Adelsfamilie aus dem Thurgau, der bereits als Kind dem St. Galler Kloster übergeben wurde, war die Klosterschule zeitlebens sein Wirkungsort. Dort bildete er die angehenden Mönche aus und für sie erstellte er lateinisches, aber auch bilinguales und deutsches Material für den Unterricht. Latein war die Bildungs- und Wissenschaftssprache; doch von Schülern aus dem germanischen Sprachraum musste Latein erst als Fremdsprache erlernt werden, nicht nur, um Texte lesen, sondern auch um Latein sprechen zu können. Hehle zeigt, dass Notker eine neue Unterrichtsmethode entwickelte, indem er die deutsche Muttersprache seiner Schüler im Unterricht verwendete. Dafür verfasste Notker die ersten lateinisch-volkssprachlichen Lehrwerke im Abendland. „Das für die Zeitgenossen Ungewohnte, Befremdliche besteht darin, dass Deutsch, die ‚Volkssprache‘, die Sprache des Alltags und der mündlichen Kommunikation, […] in ein bisher gänzlich auf das Lateinische beschränktes epistemologisches System eingefügt wird“ (13). Mit dieser Methode wertete Notker das Deutsche zur Wissenschafts- und Bildungssprache auf und schuf, wo nötig, neue (althoch-)deutsche Begriffe, wie z. B. „Geburtstag“. Nach seinem Tod freilich fand seine Methode langfristig keine Nachahmer und Notker blieb ein „Solitär“ (17).
Mit dem Einführungsbeitrag ist die Perspektive auf Notker als Pädagogen vorgegeben. Der zweite Beitrag von Andreas Nievergelt skizziert knapp Leben und Werk Notkers (18–22) aus den verfügbaren Quellentexten und bietet hier den eingangs zitierten Brief (in Übersetzung und mit Abbildung der Handschrift), in dem Notker seine Unterrichtsmethode reflektiert. In diesem Brief nennt Notker auch die von ihm verfassten Schriften und seine eigene Liste dient als Schlüssel zur Anordnung der folgenden acht Beiträge, die jeweils einzelne Aspekte von Notkers Schaffen betrachten: die Klosterschule (Philipp Lenz, 24–31), Notkers lateinische und althochdeutsche Schriften zu den Sieben Freien Künsten (Nievergelt/Lenz, 32–47), seine Übersetzung von Boethius‘ Trost der Philosophie (Dora, 48–65) und die Übersetzung und Bearbeitung von Aristoteles-Schriften (Nievergelt, 66–73). Die beiden letzten Kapitel sind Notkers verlorenen Werken (Nievergelt, 74–81) und seiner althochdeutschen Übersetzung und Kommentierung des Psalters (Franziska Schnoor, 82–89) gewidmet. Letztere galt in Notkers eigener Perspektive als sein Hauptwerk.
Die Beiträge können an dieser Stelle nicht im Einzelnen vorgestellt werden. Alle zeichnen sich aber durch große Quellennähe aus: Sie führen in Text und mit Abbildungen aus den Codices der Notker-Überlieferung in den jeweiligen Aspekt des Schaffens Notkers ein und ordnen den Einzelaspekt zugleich in den größeren Horizont der St. Galler Überlieferung und der Bildungswelt um das Jahr 1000 ein. So bieten die Beiträge nicht nur eine Einführung in Notkers Schriften, sondern auch in die mittelalterliche Bildungswelt um die Jahrtausendwende, also noch rund zwei Jahrhunderte vor der Gründung der ersten Universitäten in Europa.
Schul- und Universitätssprache blieb die nächsten Jahrhunderte das Lateinische, aber Notker habe, so sein Schüler Ekkehard IV. rühmend, das Verdienst, neben den drei Sprachen Hebräisch, Griechisch und Latein, in denen das Kreuz Jesus beschriftet war, das Deutsche als „vierte Sprache“ (91) etabliert zu haben. Der Abschlussbeitrag des Herausgebers (90–93) präzisiert diesen Ruhm seines Schülers: „Das Neuartige besteht nicht einfach darin, die deutsche Sprache im Unterricht einzusetzen, sondern sie zu den anspruchsvollsten Zwecken zu nutzen“ (91), im Ringen um eine präzise deutsche Bildungs- und Wissenschaftssprache.
Alle Beiträge sind wissenschaftlich fundiert, aber für den Lesenden ohne spezifische Vorkenntnisse aufbereitet. Der Anhang (94–108) bietet Anmerkungen mit Literaturhinweisen sowie ein Register der Handschriften.
Die Sommerausstellung 2022 liegt zwar zurück, aber der vorliegende Begleitband ist auch nach Ausstellungsende noch sehr lesenswert und rückt einen um die Jahrtausendwende herausragenden Pädagogen und Autor ins Licht.
Dr. Ulrike Treusch, Professorin für Historische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen