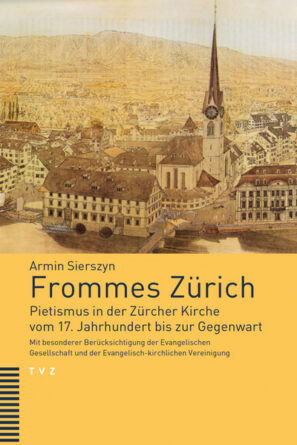Armin Sierszyn: Frommes Zürich. Pietismus in der Zürcher Kirche vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart
Armin Sierszyn: Frommes Zürich. Pietismus in der Zürcher Kirche vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mit besonderer Berücksichtigung der Evangelischen Gesellschaft und der Evangelisch-kirchlichen Vereinigung, hg. v. der Evangelisch-Kirchlichen Vereinigung, Zürich: TVZ, 2023, Pb., 344 S., € 39,–, ISBN-13 978-3-290-18543-5; E-Book PDF 978-3-290-18544-2
Aus deutscher Sicht wird der Schweizer Pietismus eher in Basel als in Zürich verortet, befinden sich doch in der alten Handelsstadt am Rhein die großen pietistischen Institutionen der Basler Mission, der Pilgermission St. Chrischona, des Diakonissen-Mutterhauses Riehen und viele weitere, kleinere Einrichtungen. Diese standen auch in regem Austausch besonders mit entsprechenden Kreisen im Süden Deutschlands und hatten durch Absolventen der theologischen Seminare eine überregionale Ausstrahlung. – Doch wie entwickelte sich der Pietismus in Bern, in Zürich und darüber hinaus in den frankophonen Gebieten der Schweiz? Im dritten Band der sehr verdienstvollen Geschichte des Pietismus (19. und 20. Jahrhundert, Göttingen: V&R, 2000) kommen Bern und Zürich nur am Rande vor, als hätten lebendige transnationale Beziehungen der deutschsprachigen erweckten Kreise diesseits und jenseits der Grenze nicht existiert.
Armin Sierszyn (Aussprache: Schérschien), ehemaliger Pfarrer und Dekan der Zürcher Landeskirche und Professor für Kirchengeschichte und Praktische Theologie an der STH Basel in Riehen, hat mit dem vorliegenden Buch seine umfangreichen Studien zum Zürcher Pietismus zusammengefasst und in hohem Alter herausgegeben. Viele deutsche Pfarrer kennen Sierszyn persönlich durch die Theologiestudenten-Freizeitarbeit des Betheler Freundeskreises.
In einundzwanzig Abschnitten stellt Sierszyn den Pietismus der Zürcher Kirche in Auseinandersetzung mit zeitgenössischen, lokal wirksam werdenden Strömungen in Theologie, Kirche und Gesellschaft dar. Er konzentriert sich dabei besonders auf die für den Verlauf der Pietismusgeschichte wichtige Evangelische Gesellschaft (EG) und die Evangelisch-kirchliche Vereinigung (EKVZ). Die EG entwickelt sich in Phasen von den 1830er-Jahren an bis etwa 1890, trifft auf zunehmende liberal-kirchliche und weltlich-säkulare Opposition in der Zeit der Belle Époque bis zum Zweiten Weltkrieg und befindet sich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts von der 68er-Kulturrevolution an bis 1990 in einer geistlichen Sterbephase.
Rund hundert Seiten widmet der Verfasser kürzer (Orthodoxie, Aufklärung, Liberalismus) oder länger (Pietismus ab 1680, Lavater, Gessner) der kirchlichen und geistlichen Entwicklung in der Stadt und Landschaft Zürich vor dem 19. Jahrhundert (17–125, Abschn. 1–8). Wie in anderen Regionen wird diese Zeit durch die Gegnerschaft gegen die Frömmigkeitsbewegungen charakterisiert, zuerst vonseiten der Orthodoxie, dann durch Aufklärung und Liberalismus in Staat und Kirche. Die belegte Verfolgung von 216 Pietisten bis 1721 führt zu Haftstrafen, Radikalisierungen und Flucht aus der Heimat, schließlich zum Rückzug in die Innerlichkeit (38). Herrnhuter und Pietisten unterstützen mit einem ersten Missions-Hilfsverein die von Halle und Herrnhut ausgesandten Missionare (32, 42). Es gibt wenige pietistische Pfarrer, wie Kaspar Füssli (1683–1752) und den Pfarrer am Fraumünster Johann Kaspar Ulrich (1705–1768). Johann Caspar Lavater (1741–1801) und Johann Jakob Hess (1741–1828) bringen das Evangelium in der Zeit der französischen Revolution zur Geltung (70), sie sind Vorläufer des Zürcher Pietismus im 19. Jahrhundert. Hess wird 1812 Gründungspräsident der örtlichen Bibelgesellschaft und 1819 Mitbegründer der Missionsgesellschaft (71). Prägende Figur der Zürcher Frömmigkeitsbewegung wird bis ins 19. Jahrhundert hinein der Pfarrer am Fraumünster und Großmünster Georg Gessner (1765–1843). Gessner fördert die wachsende Arbeit von Bibel- und Missionsgesellschaft (Abschn. 6). Die Erweckung hat allerdings eine begrenzte Wirkung, sie erfasst – anders als in England und den USA – nicht weite Teile der Bevölkerung und prägt nicht die Kultur von Grund auf neu (108).
Lokale Erweckungen mit teils hunderten von Teilnehmern prägen im 19. Jahrhundert Ortschaften der Zürcher Landschaft (Abschn. 9, 127–151). Liberale Opposition führt zur Bildung von Herrnhuter Gemeinschaften, Minoritätenkirchen innerhalb der Landeskirche, zu Stadtmissionen und zu vielen freien Einrichtungen wie Schulen, Herbergen zur Heimat, zur Gründung der Gebets-Heilanstalt in Männedorf, aber auch zu neutäuferischen Versammlungen und enthusiastischen Exzessen. Um der starken Verweltlichung in Staat und Kirche zu begegnen, wird in den 1830er Jahren die Evangelische Gesellschaft mit ähnlichen Zielsetzungen wie fünfzig Jahre zuvor in Basel die Christentumsgesellschaft gegründet (Abschn. 10, 153–175). Sie entfaltet eine umfangreiche Arbeit in allen denkbaren diakonischen Arbeitszweigen, von Schriftenmission über Missionsförderung, „Rettungshäuser“, Krankenhilfe bis hin zu Bildungsinitiativen (Sonntagsschulen) sowie evangelistischer und pädagogischer Arbeit. Besonders stark wächst die Arbeit in den 1870er- bis 1880er-Jahren. In der Kirche wird darum gestritten, ob der Inhalt des Apostolikums wortwörtlich zu glauben sei (157f, 180f, 230f). Der zeitweilig in Zürich lehrende Erlanger Reformierte August Ebrard bewirkt, dass das Apostolikum in die Statuten der Evangelischen Gesellschaft aufgenommen wird (173f). Die großen ersatzreligiösen Mächte Idealismus, Materialismus, Nationalismus und Romantik entstehen im 18. und 19. und entfalten ihre volle Wirkung im 20. Jahrhundert (170). Der Kampf zwischen Bibel und Glaube einerseits sowie Säkularisierung andererseits führt in der Belle Époque (parallel zur dt. Kaiserzeit) im pietistischen Milieu zur Gründung des Schweizerischen evangelisch-kirchlichen Vereins (SEKV), in Kirche und Gesellschaft aber auch zu religiöser und geistlicher Gleichgültigkeit (Abschnitte 11 und 12, 177–235). Die Zahl der pietistischen Angebote ist so groß wie nie zuvor, aber der anfängliche Schwung erlahmt (225f, 228, 238f „Bekenntnismüdigkeit“). Die Geschichte der „positiven“ Vereinigungen in Stadt und Kanton Zürich ist im 20. Jahrhundert von Fusionen geprägt (Abschn. 13). In den 1920er Jahren gibt es große volksmissionarische Aktionen in der Zürcher Landschaft und finanzielle Schwierigkeiten im Diakoniewerk Neumünster; der Aufstieg teils säkularer, teils neuheidnischer marxistischer und nationalsozialistischer Ideologien prägt die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg (Abschnitte 14–16).
In der Nachkriegszeit sieht Sierszyn die historisch-kritische Theologie als Türöffnerin säkularer Ideologien, während die 1968er-Kulturrevolution auf einer Remythologisierung historischer Gesellschaftsverhältnisse beruht (Abschn. 17). Ausführlich bespricht der Verfasser die geistliche Sterbephase der Evangelischen Gesellschaft (1944: „seit Jahren auf dem Rückzug“, 273) und der Evangelisch-Kirchlichen Vereinigung (EKV) 1945–1990, die von zeitgeistig-kirchlicher Beeinflussung herrührt (Abschn. 18, 273–298). In der neusten Zeit (1982–1990, ab 1990) werden verschiedene Trends sichtbar; einerseits wird das missionarisch-evangelistische Erbe wieder aktiviert, andererseits bleibt die Anpassung an die Zeit ein Grundproblem im Ringen um Theologie, Gesellschaft und den landeskirchlichen Kurs (Abschn. 19 und 20). Ein zusammenfassender und mit optimistischen Reformvorschlägen auf die Zürcher Situation zielender Epilog beschließt das Buch (Abschn. 21, 337–340), das zwar qualitativ gute Abbildungen und ordentliche Bildnachweise (341–344), aber leider keine Register besitzt.
Dem Autor ist zu danken, dass er in hohem Alter diese wichtige Untersuchung noch fertiggestellt hat. Sein persönliches Engagement zeigt sich an vielen Stellen in der Darstellung der Entwicklung im 20. Jahrhundert. In der vorliegenden Studie stellt Sierszyn nicht nur wissenschaftlich-deskriptiv und distanziert Entwicklungen dar, sondern analysiert auch geistlich die philosophisch geprägten Strömungen der Zeit und urteilt auf klarer biblisch-theologischer Grundlage.
Es wäre allerdings interessant gewesen, nicht nur den kirchlichen Liberalismus als Antagonisten pietistischer Aktivitäten, sondern auch die entstehenden Freikirchen als Co-Agonisten zumindest etwas stärker in die Ausführungen zu integrieren. Namentlich das 21. Jahrhundert ist von großer Fluktuation zwischen den Gemeinden unterschiedlicher Konfession geprägt. So muss vermutet werden, dass die aus gleicher geistlicher Wurzel stammenden semi- bis schon im Ursprung separatistischen Freikirchen wie Chrischona (Viva-Kirchen Schweiz), FEG, EFG, Neutäufer (ETG, Nazarener), Mennoniten- und Brüdergemeinden durch Transferwachstum von der Evangelischen Gesellschaft profitiert haben. Im Kanton Zürich existiert zudem eine lebendige Szene bundfreier Gemeinden, die überwiegend auf der Grundlage der Evangelischen Allianz zusammenarbeiten und zum Teil überregional von Bedeutung sind (vgl. https://allianz-zuerich.ch/ Stand 1.04.2025): ICF – Kirche neu erleben, Equippers Friedenskirche Zürich, Hillsong Church, Vineyard und Stiftung Schleife Winterthur, um nur die bekanntesten Institutionen zu nennen. Mit Blick auf Wachstum und Zahl der freien Gemeinden lässt sich ein Trend feststellen, der die kirchliche Szene in den USA schon länger prägt: Dort werden die schwindenden bisherigen Mainline denominations von einer wachsenden Zahl großer selbständiger Gemeinden überrundet. Warum sollte so nicht auch die Zukunft des evangelischen Christentums in der Schweiz (und in Deutschland) aussehen?
Pfarrer Dr. Jochen Eber, Schriesheim