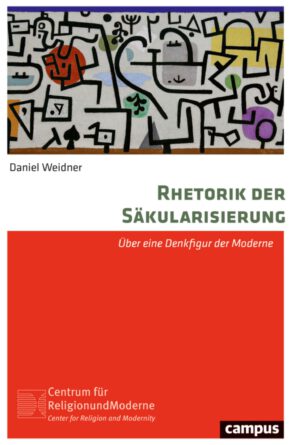Daniel Weidner: Rhetorik der Säkularisierung
Daniel Weidner: Rhetorik der Säkularisierung. Über eine Denkfigur der Moderne, Religion und Moderne 30, Frankfurt: Campus, 2024, kt., 243 S., € 29,–, ISBN 978-3-593-51831-2
Ist das Wort Säkularisierung nicht selbsterklärend? Obwohl heutzutage viele, sich stark ähnelnde Vorstellungen darüber in Umlauf sind, ist der Begriff nicht so eindeutig, wie man meinen mag. Daniel Weidner arbeitet als Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Halle-Wittenberg und er beobachtet: Mit der Rückkehr der Rede von der Religion seit den 1990er Jahren sei im öffentlichen Diskurs auch das Interesse an der Frage nach der Säkularisierung gestiegen, was wiederum mit dem Selbstverständnis des modernen Westens zu tun habe.
In Kapitel 1 vergleicht Weidner zunächst vier aktuelle Theorieentwürfe (Charles Taylor, Giorgio Agamben, Talal Asad, Jürgen Habermas) und skizziert die daran anschließenden Diskussionen. Deutlich wird, dass die genannten Denker zu demselben Thema gewichtige Beiträge liefern, gleichzeitig aber sehr uneinheitlich und teils unpräzise vorgehen. Kapitel 2 analysiert im Kontrast dazu drei substanzielle Kritiken: Hermann Lübbe bewertet den Ausdruck als politisches Schlagwort zur Bezeichnung der Moderne; Hans Blumenberg sieht darin eine begriffliche Fehlbezeichnung und versteht Säkularisierung eher als geschichtsphilosophisches Programm; Albrecht Koschorke hingegen meint dahinter ein abgenutztes, kulturelles Narrativ nach dem Schwund der Religion zu erkennen.
Aufbauend auf diese explorativ-thematische Problemabsteckung widmet sich Weidner in Kapitel 3 dem weiteren Vorgehen seiner Studie: Anstatt einen statischen Begriff zu analysieren, möchte der Germanist und Komparatist die Rhetorik der Säkularisierung und ihre Genealogie untersuchen. Diese Doppelperspektive ermögliche es noch stärker, die komplexen und oftmals indirekten Nuancen in der Redeweise zu verstehen, wie auch die vieldeutigen Interpretationsketten und narrativen Dimensionen in den Fachdebatten über Säkularisierung.
Auf diese Grundlegung folgen dann 28 dicht geschriebene Kapitel, in denen der Professor auf einflussreiche Denker des 20. Jahrhunderts eingeht. Angefangen bei Max Weber, über Georg Simmel, Rudolf Bultmann und andere, bis hin zu Thomas Luckmann und dem bereits erwähnten Blumenberg nimmt er seine Leser in ein anspruchsvolles Close Reading relevanter Primärtexte hinein. Dabei kommentiert Weidner die intellektuellen Verbindungen zwischen den Autoren und ihren jeweiligen Standpunkten. Er zeichnet ideengeschichtliche Entwicklungen nach und arbeitet (teils minutiös) die Axiome, Argumentationen oder ethisch-weltanschaulichen Stoßrichtungen der Autoren heraus.
Das abschließende Kapitel unterstreicht, wie unterschiedlich sich die Sozial- und Literaturwissenschaften, Philosophie, Theologie und andere Disziplinen seit dem Jahr 1900 dem Schlagwort Säkularisierung genähert haben – sei es in Ablehnung, Anlehnung, Zuwendung oder Spannung zur Religion, von der man im säkularen Zeitalter oft nur noch indirekt spricht. Angesichts der Vielschichtigkeit in der Rede von Säkularisierung spricht sich Weidner dafür aus, das Wort nicht als reinen Containerbegriff zu verstehen. Dafür leiste der Ausdruck zu viel. Anstatt klare Zuschreibungen und Definitionen zu liefern, funktioniere Säkularisierung v. a. als bildliche Rede: Sie drücke Ähnlichkeiten aus, ermögliche Übertragungen und problematisiere diese sogleich wieder.
Am Umgang mit dem Ausdruck zeige sich anschaulich: „Rhetorische Figuren wie auch Erzählungen behaupten nicht nur Übergänge, sondern vollziehen sie auch; sie können deshalb immer beides zugleich machen: Grenzen aufstellen und sie überschreiten, eine Logik behaupten und sie untergraben.“ (226) Gerade weil das Wort so viel umfasst, sollte man laut Weidner die Säkularisierung vielmehr als große Erzählung lesen und entsprechend zu Ende denken, d.h. „als absolute Metapher, die man nicht einfach auslösen kann, sondern entfalten muss, als letzten Mythos der Moderne, der nicht überwunden, sondern durchgearbeitet werden will.“ (29)
Die Studie Rhetorik der Säkularisierung bietet eine anspruchsvolle Beschäftigung mit einem bedeutungsschweren und mehrschichtigen Konzept, das offensichtlich mehr ist als nur dies. Anfangs wirkt Weidners Ansatz etwas ungewöhnlich, dann aber verhilft seine Klassiker-Auswahl, sein genealogisches Vorgehen und der Blick auf rhetorische Tiefenstrukturen zu vielen interessanten Einsichten. Einerseits möchte der Autor weder eine eigene Säkularisierungstheorie entwickeln noch eine Sachkritik, eine Begriffs- oder gar Diskursgeschichte vorlegen. Andererseits analysiert er die verschiedenen Perspektiven kritisch und pointiert; mitunter lässt er auch eigene Ansichten durchscheinen, die über das Deskriptive von vermeintlichen intertextuellen Sprachspielen hinausgehen. Das macht die Lektüre anspruchsvoll, aber auch anregend.
Dennoch drängt sich dem Leser irgendwann eine gewisse Spannung auf. Denn trotz aller Tiefe wirkt die Beschäftigung mit den einzelnen Denkern stellenweise unverhältnismäßig kompakt, der Religionsbegriff fungiert eher als stiller Komparse, und Weidners Nachdenken über die Säkularisierung – quasi auf der Metaebene in Stichproben – entzieht sich am Ende einem klaren Fazit.
Vielleicht macht dies wiederum die Stärke des Buches aus: Trotz seines Kontextbewusstseins auf der historischen und religionssoziologischen Ebene transzendiert die Studie etablierte Perspektiven zur Säkularisierung. Der Titel präsentiert frühere Denkweisen gewissermaßen durchleuchtet und in neuer Form, und dient auf diese Weise als Ergänzung zu anderen empfehlenswerten, doch vergleichsweise konventionellen Werken (z.B. Thomas Schmidt / Annette Pitschmann (Hg.): Religion und Säkularisierung. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart: Metzler, 2014).
Lehrkräfte aus der Praktischen Theologie und Studierende mit Vorwissen können sich hier für eine eigenständige Auseinandersetzung mit dem Thema Säkularisierung sensibilisieren lassen. Weidners Studie ist letztlich eine lesenswerte und hilfreiche Ressource, die helfen kann, heutige gesellschaftliche Diskurse konstruktiv zu hinterfragen sowie das eigene kirchliche Engagement in einem nach-christentümlichen Kontext noch differenzierter zu reflektieren und zu gestalten.
Daniel Vullriede, M.A., M.A., Dozent am Bibelseminar Bonn und IBEI Rom