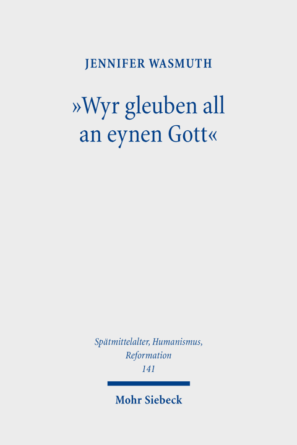Jennifer Wasmuth: „Wyr gleuben all an eynen Gott“
Jennifer Wasmuth: „Wyr gleuben all an eynen Gott“. Das Nicaeno-Constantinopolitanum in seiner Bedeutung für Martin Luther und Philipp Melanchthon, Spätmittelalter, Humanismus, Reformation / Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation (SMHR) 141, Tübingen: Mohr Siebeck, 2024, geb., 601 S., € 119,– ISBN 978-3-16-161538-2
In ökumenischen Gesprächen nimmt das „Nicaeno-Constantinopolitanum“ (NC) eine prominente Stellung ein, um eine gemeinsame Bekenntnistradition trotz konfessioneller Unterschiede zu betonen. Denn nahezu alle Spielarten der nachkonstantinischen Kirchen stimmen darin überein, dass es der dreieinige Gott war, der die Kirche gründete und auch erhalten wird.
In diesem Jahr besinnt sich die weltweite Christenheit auf das erste Konzil von ökumenischer Tragweite zurück, das im Jahr 325 in Nizäa (heute İznik, Türkei) tagte. Die gemeinsamen Feierlichkeiten der Kirchen zu diesem Jubiläum sind von einem Geist der Einheit getragen, in der die Kirchen ihre gegenseitige Verbundenheit auf der Grundlage des NCs betonen. Aber ist dieses Bekenntnis zum Bekenntnis ausreichend, um gemeinsam in die Zukunft zu blicken? Denn die Gestalt der Konfessionen geht mitunter auf die Auslegung des NCs zurück, ein Umstand, den die Kirchenführer bei aller Aufbruchstimmung auf dem Weg zu einer Kirche vergessen zu haben scheinen.
Die Habilitation von Frau Jennifer Wasmuth setzt genau hier an. Sie zeigt die Rezeption des NCs bei Luther und Melanchthon und wie ihre Interpretationen zu einer Ausformung einer spezifisch lutherischen Theologie beitrugen.
Den Forschungsteil gliedert W. einerseits nach der reformatorischen NC-Rezeption im Lichte der Dogmengeschichtsschreibung des 19./20. Jahrhunderts, andererseits nach dem gegenwärtigen Forschungsstand der Rezeption des NC in der Reformation.
Der Hauptteil ihrer Arbeit ist klar gegliedert: (1) Zunächst fragt W. nach der Bedeutung des NCs im Spätmittelalter. Hier zeigt sich, dass das NC deutlich weniger verbreitet als das Apostolicum war, obgleich dessen Auslegung sich am NC und Athanasianum orientieren musste. „Das NC – und mit ihm das Athanasianum – galt damit als die herrschende dogmatische Norm“ (123). (2) Danach klopft W. Luthers Rezeption des NCs unter verschiedenen Gesichtspunkten ab, so u. a. in seinen Gottesdienstordnungen, Liedgut, Predigten und Katechismen. Überraschendes fördert W. hier zutage. Ausgehend von Luthers Streichung des „gläuben und“ im ersten Hauptteil der Artikel: „Diese Artikel sind in keinem Zank noch Streit, weil wir zu beiden Teilen dieselbigen gläuben und bekennen“ legt sie überzeugend dar, dass für Luther die bloße gemeinsame Bekenntnisgrundlage für ein ökumenischer Gespräch nicht ausreichend war, sondern dieses Bekenntnis „muss im rechten Glauben angenommen werden“ (211). Entgegen der geläufigen Forschungsmeinung, dass Luther auf das NC insistierte, weil es Reichsrecht war und er die reformatorische Kirche auf einen juristisch gesicherten Boden stellen wollte, verhielt er sich geradezu entgegengesetzt. Etwa in seiner Schrift gegen Latomus problematisierte er das Homousios (188–191) und in den Schmalkaldischen Artikeln führte er das Athanasianum statt des NCs an (212). Überhaupt beobachtet W. sehr scharf, dass Luther für seine biblische Begründung der altkirchlichen Trinitätslehre in einem viel höheren Maß auf das Apostolicum und Athanasianum als auf das NC zurückgriff. Offenbar „war […]“ Luther „[…] an dem Text des NC nicht sonderlich gelegen.“ (173) (3) Schließlich beschäftigt sich W. mit Melanchthons NC-Rezeption. W. grenzt sich von dem Forschungsurteil eines konzilianten Melanchthon deutlich ab, eines „Leisetreter[s]“ gegenüber Luther, und zeichnet das Bild eines Melanchthon, der gegenüber Täufern und Antitrinitariern unerbittlich war, um gegenüber den Feinden der Reformation ihre Übereinstimmung mit den Lehrentscheidungen der Alten Kirche zu demonstrieren (454–455). Viel stärker als Luther rezipierte er das NC, „weil [… es] sowohl der dogmatischen Vergewisserung nach ,innen‘ als auch der apologetischen Absicherung nach ,außen‘ in besonderer Weise zu dienen vermag“ (290). W. beobachtet, dass, obgleich Melanchthon sich viel intensiver mit dem NC auseinandersetzte als Luther, er „den Zusammenhang zwischen Gotteslehre und Soteriologie“ dennoch nicht klar herausstellte und sich in Spekulationen verlor (458).
Alles in allem ist das Buch eine gelungene Arbeit. Der an dieser Themenstellung interessierte Leser wird nicht zu kurz kommen, sondern wird beim Lesen von Erkenntnis zu Erkenntnis hecheln müssen.
Vikar Jonathan Schneeweiß, Doktorand, Ebhausen