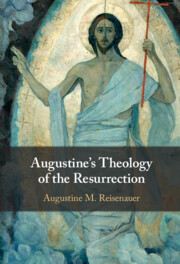Augustine M. Reisenauer: Augustine’s Theology of the Resurrection
Augustine M. Reisenauer: Augustine’s Theology of the Resurrection, Cambridge: Cambridge University Press, 2023, Hb., XVI+275 S., £ 88,–, ISBN 978-1-009-26906-3
Augustin von Hippo starb am 28. August 430, Bußpsalmen betend und mit festem Glauben an die Auferstehung. Die Auferstehung ist keinesfalls lediglich ein kirchliches Dogma, vielmehr persönlich erlebte Realität und Hoffnung für den Bischof von Hippo. Diese Perspektive leitet den Dominikaner Augustine M. Reisenauer, der mit Augustine’s Theology of the Resurrection sein erstes Buch vorlegt. Es verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Die Zentralität der Auferstehung in Augustins Denken und Werk soll offengelegt werden. Damit nimmt der Autor eine Spur auf, die von Gerald O’Collins gelegt worden ist. Während dieser besonders die Auferstehung Jesu Christi in den Blick nimmt und die moderne Relevanz der Apologetik Augustins aufzeigt, will Reisenauer auch die Auferstehung der gesamten Menschheit bedenken sowie Augustins Denkprozess nachvollziehen. Der lose chronologische Aufbau unterstützt dies im ersten Abschnitt, im weiteren Verlauf werden frühe und späte Texte Augustins gemischt herangezogen, ohne dass dies explizit kontextualisiert und problematisiert wird.
Das Buch besteht aus vier Teilen mit jeweils drei Kapiteln und ist insgesamt hervorragend zu lesen. Reisenauers breite Kenntnis des augustinischen Œuvres quer durch seine Genres und Schaffensperioden sowie sein immenser Respekt für den Kirchenvater sind klar erkennbar. Der Verfasser versteht es, die vielfältigen Themen nicht ausufern zu lassen, sondern sich stets auf sein Hauptanliegen zu konzentrieren. Dass dabei einige augustinische Kernpunkte nur sehr knapp angeschnitten werden, ist unvermeidlich. Bemerkenswert ist, dass Reisenauer die Auferstehung nicht nur theologisch analysiert, sondern deutlich macht, dass sie letztlich nur von ‚innen‘ verstanden werden kann, von jenen, die selbst Teil dieses Mysteriums sind; an mehreren Stellen wird eine tiefe Ehrfurcht vor diesem zentralen Glaubensgeheimnis spürbar.
Im ersten Hauptteil Early Considerations of the Resurrection (17–71) zeigt Reisenauer auf, dass Augustin bereits in seinen frühesten Schriften von der Auferstehung spricht, und führt vor, warum er die Charakterisierung Augustins nach seiner Bekehrung als Platoniker oder Krypto-Manichäer für nicht haltbar hält. Bereits hier könne Augustin positiv von der Inkarnation und der leiblichen Auferstehung Christi sprechen, auch wenn viele Äußerungen noch unklar sind und weiterer Ausarbeitungen bedürfen. Die in diesem frühen Stadium entwickelten Theorien der Auferstehung als eine Rückkehr zu Eden und etwas später als Verwandlung in einen Engelskörper interpretiert Reisenauer als experimentelle Theologie. Eindrücklich betont er, dass Augustin zwar sein Verständnis weiterentwickelt, doch dabei tiefer in die biblische Offenbarung eintaucht und Änderungen zulasten philosophischer Vorannahmen vornimmt. Der überlieferte Auferstehungsglaube ist für ihn eine Konstante, in dessen Mysterium er tiefer eintaucht und der als hermeneutische Mitte Anthropologie, Kosmologie und Eschatologie neu ordnet.
Im zweiten Abschnitt The Resurrection of Jesus Christ (73–118) erläutert Reisenauer, wie Augustin in Contra Faustum Manicheum (datiert auf 400/402) zu dem „culminating moment of theological coherence“ (73) gelangt, indem er die Auferstehung Jesu Christi reflektiert. In der antimanichäischen Auseinandersetzung lernt und verteidigt er die bleibende Bedeutung des menschlichen Körpers Jesu, der durch die Auferstehung Unverweslichkeit erlangt: „the flesh itself is changed for the better, not exchanged for something better“ (82; vgl. 147). Bereits hier kann man dem auferstandenen Christus im Glauben begegnen, seine Auferstehung ist auf das engste verbunden mit der der Gläubigen. Christi ‚Pascha-Mysterium‘ (ein Lieblingsausdruck des römisch-katholischen Autors) stelle für die Gläubigen sowohl sacramentum hinsichtlich der geistlichen als auch exemplum hinsichtlich der leiblichen Auferstehung dar.
Diese beiden Dimensionen werden im Folgenden entfaltet, wobei sich zunächst der dritte Abschnitt The Resurrection of the Human Spirit (119–172) der historischen, in der Zeit erlebten Auferstehung — pietistisch der ‚Bekehrung’ — widmet. Soteriologie wird hier durch die Brille der Auferstehung verstanden, wobei die geistliche Auferstehung zugleich an die leibliche Auferstehung geknüpft und ihre Voraussetzung ist. Besonders interessant ist Kapitel 8, in dem der Verfasser Augustins Confessiones als eine Auferstehungsgeschichte interpretiert: es sei „the story of how the God of Jesus Christ resurrected his soul from spiritual death in sin to spiritual life in the risen Lord.“ (139) Ob Reisenauers These in dieser Zuspitzung tragfähig ist, bleibt abzuwarten, schließlich ist conf. ein vielschichtiges Werk mit reicher Motivik und Bildersprache. Jedoch ist es sein Verdienst, die Auferstehung als existenzielle, theologische Deutung des Lebens Augustins sichtbar zu machen. Immer wieder weist der Autor darauf hin, was für eine radikale Neuausrichtung durch die geistliche Auferstehung im Leben eines Gläubigen gegeben ist, nicht zuletzt hinsichtlich seiner Einbindung in die sakramentale Gemeinschaft der Kirche, die gemeinsam die endzeitliche Auferstehung erwartet.
Mit dieser eschatologischen Auferstehung beschäftigt sich der vierte Hauptteil The Resurrection of the Human Flesh (173–240). Zunächst bespricht Reisenauer Augustins Verteidigung der leiblichen Auferstehung gegen (platonische) Kritik. Wenn auch die Auferstehung der toten Körper am Ende der Zeit sich unserer Erfahrung entzieht, habe der Glaube daran und das theologische Nachdenken darüber doch eine feste Grundlage in der Schrift und dem auferstandenen Christus. Was Reisenauer „eschatological imagination“ (216) nennt, habe auch den spirituellen Sinn, die Gläubigen mehr und mehr auf die Auferstehung hin auszurichten. Besonders die beiden letzten Bücher von De civitate Dei leiten schließlich Reisenauers Ausführungen zu der leiblichen Auferstehung der Verdammten beziehungsweise der Erlösten. Dabei beweist Augustin ein feines Gespür für Grenzfälle menschlicher Existenz: auch siamesische Zwillinge, Menschen mit extremen Behinderungen oder Föten, die in der Welt kaum als Menschen im vollen Sinne anerkannt wurden beziehungsweise werden, sind in seiner Sicht Träger der Auferstehungshoffnung. Gerade an ihnen erweist sich Gottes Macht und Güte in der eschatologischen leiblichen Auferstehung: „The resurrection is humanity’s crowning comeback. It is our finest moment of resilience, the gracious accomplishment of which belongs to the God of the resurrection.“ (5)
Es ist zu bedauern, dass formale Gegebenheiten, wie das Fehlen eines Stellenregisters, die ungewöhnlich organisierte Bibliographie und fehlende lateinische Textstellen, die Nutzung etwas erschweren. Für die Augustinforschung hat Reisenauers Buch dennoch einen hohen Wert, gibt es doch Anlass, Augustins Werke sowie theologische Kernthemen in neuem Licht, nämlich im Licht der Auferstehung zu betrachten. Auch für Gläubige ohne kirchengeschichtlichen Schwerpunkt ist das Buch in höchstem Maße fruchtbar, es führt nicht nur in Augustins Reflexionsprozess ein, sondern leitet zugleich in immer tiefere Dimensionen des Mysteriums der Auferstehung.
Heindrikje Kuhs, Mühlacker