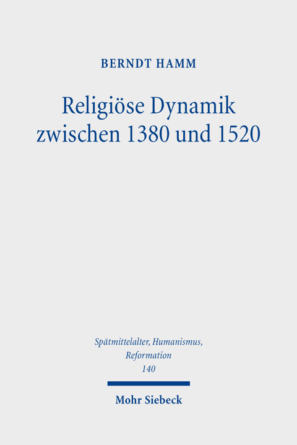Berndt Hamm: Religiöse Dynamik zwischen 1380 und 1520
Berndt Hamm: Religiöse Dynamik zwischen 1380 und 1520. Antriebskräfte der Mentalität, Frömmigkeit, Theologie, Bildkultur und Kirchenreform, Spätmittelalter, Humanismus, Reformation / Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation 140, Tübingen: Mohr Siebeck, 2024, geb., Ln., XXII+594 S., € 119,–, ISBN 978-3-16-16377346
Mit dem knapp 600 Seiten starken Band legt Berndt Hamm, emeritierter Professor für Kirchengeschichte an der Universität Erlangen, in gewisser Weise die Summe seiner bisherigen zahlreichen Forschungsbeiträge in den letzten vier Jahrzehnten zum Verhältnis von Spätmittelalter und Reformation vor, oder um es präziser zu sagen: seine Beiträge zur Überwindung einer starren Epochenabgrenzung, indem er die „religiöse Dynamik“ zwischen 1380 und 1520 sichtbar macht. Dabei hält Hamm an der Besonderheit der (lutherischen) Reformation fest: „Das besondere Profil der Reformation und ihrer verschiedenen konkreten Verlaufsformen liegt jeweils in der Kombination von Ingredienzien des Mittelalters und der durch Luther angestoßenen variationsreichen Neuorientierungen“ (25). Diese Grundthese entfaltet der Autor nach einem einführenden Kapitel (Kap. 1) in zwölf exemplarischen Studien, die die religiöse Dynamik phänomenologisch (VII) auffächern und auf bereits veröffentlichte, aber intensiv überarbeitete Aufsätze des Autors zurückgehen. Mit den ausgewählten Aspekten von Theologie-, Frömmigkeits- und Mentalitätsgeschichte erhebt Hamm keinen Anspruch auf Vollständigkeit („So berücksichtige ich viel zu wenig die konziliare Reformdynamik […] oder die apokalyptische Dynamik um 1500 […] und die religiöse Dynamik des geistlichen Musikschaffens“; IX). Doch haben die auf den knapp 600 Seiten mit 46 Abbildungen angesprochenen Themen kompendienhaften Charakter, wobei Hamm jedes Thema zunächst grundsätzlich darstellt und dann an der Reichsstadt Ulm, gelegentlich auch Nürnberg, als „urbane Kulmination der religiösen Dynamik“ (63) exemplifiziert.
Die Themenfülle zeigt bereits das achtseitige Inhaltsverzeichnis (XV–XXIII). Im ersten Kapitel (1–75) erläutert Hamm den Begriff der Dynamik als „Schlüssel zu Verständnis und Darstellung religiöser Phänomene“ (1) und zur Beschreibung des „Wirksamwerden[s] von kulturellen, ökonomischen, sozialen, politischen und insbesondere bemerkenswerten religiösen Antriebskräften zwischen dem ausgehenden 14. Jahrhundert und dem Beginn der Reformation“ (1). Hamm geht zunächst auf die forschungsgeschichtlich negative Wertung des Spätmittelalters ein und knüpft an die Neuausrichtung des Epochenverständnisses durch Heiko A. Oberman an, die ihn zur Absage an „Epochenbewertungen und an ein teleologisches Entwicklungsdenken“ (25) führt. Stattdessen will Hamm ohne Werturteil die Dynamik(en) des späten 14. bis frühen 16. Jahrhunderts betrachten, wobei er zum Ausgangspunkt das Jahr 1380 als Beginn konziliarer Theologie wählt und den Schlusspunkt im Jahr 1520 setzt wegen der durch das Populärwerden Luthers „grundlegenden Legitimationskrise des bisherigen Kirchenwesens“ (30). Innerhalb dieses Zeitrahmens entfaltet Hamm in den folgenden Kapitel Facetten einer religiösen Dynamik.
Die Kapitel 2 bis 4 setzen zunächst die Charakterisierung der Zeit fort: Hamm stellt gegen ein Epochendenken das „dynamische Verhältnis von Spätmittelalter und Reformation“ (Kap. 2) vor, um anschließend das 15. Jahrhundert als „Ära einer Expansion, Entgrenzung und Laisierung der Theologie“ (110) zu charakterisieren (Kap. 3). Die Dynamik einer Synthese von Humanismus, Theologie und Frömmigkeit erläutert Hamm in Kap. 4, wobei er die begrifflich von ihm geschaffene und in der Forschung rezipierte „Frömmigkeitstheologie“ des 15. Jahrhunderts im Verhältnis zum Humanismus betrachtet.
Von dieser theologischen Grundlage ausgehend, vertieft Hamm in den Kapiteln 5 bis 13 stärker material theologische, frömmigkeits- und mentalitätsgeschichtliche Phänomene der Dynamik, die in der Reformation weiterwirkten: die Dynamik von „Barmherzigkeit, Gnade und Schutz“ (Kap. 5), die eschatologische Dynamik mit dem Hervortreten des Individualgerichts (Kap. 7), die „Dynamik visueller Vergegenwärtigung“ (Kap. 8) in Frömmigkeitsbildern, die „Innovationsdynamik der ,Kunst des heilsamen Sterbens‘ (Ars moriendi)“ (Kap. 9), die „Entgrenzungsdynamik des Ablasses“ (Kap. 10), die „Publikationsdynamik“ (Kap 11), die „Dynamik der Nahwallfahrten im Kraftfeld von Mobilität und ,naher Gnade‘“ (Kap. 12) und die „Dynamik religiöser Aufmerksamkeitslenkung“ in der Seelsorge (Kap. 13). Dabei bezieht Hamm neben lateinischen und volkssprachlichen Textquellen auch kunstgeschichtliche Darstellungen ein, so z. B. wenn er die Ikonographie des Herlin-Altars der Reichsstadt Bopfingen als Zeugnis religiöser Dynamik (Kap. 6) vorstellt.
Exemplarisch soll hier seine Darstellung der Dynamik des Ablasses (Kap. 10) näher betrachtet werden, ist es doch gerade der Ablass, an dem die Reformation in klarem Gegensatz zur spätmittelalterlichen Lehre und Praxis zu stehen scheint: „Ausgerechnet an diesem Punkt tiefgehende Gemeinsamkeiten zwischen dem ausgehenden Mittelalter und den Antriebskräften der Reformation aufzeigen zu wollen, dürfte sehr befremdlich wirken“ (341). Hamm zeigt, inwiefern der Ablass als Vergebung der zeitlichen Sündenstrafen, die der Mensch nach mittelalterlicher Lehre entweder noch zu Lebzeiten oder im Fegfeuer zu büßen hatte, ein der Reformation vergleichbares Anliegen hatte, nämlich die Sicherung der Gnadenzuwendung Gottes. Er versteht die inflationäre Ablasspraxis des 15. Jahrhunderts als Höhepunkt der mittelalterlichen Gnadenfrömmigkeit und als „Teil einer großen Entängstigungs- und Entlastungsstrategie der Kirche“ (345). In dieser Perspektive erkennt Hamm religiöse Antriebskräfte, „die das Ablasswesen mit den Ursprungsimpulsen Luthers und der Reformation verbinden“ (355): „Es ist genau diese spätmittelalterliche Dynamik der tröstenden Gewissensentlastung, der Minimisierung des menschlichen Eigenbeitrags […] und der Betonung des Glaubens […], die von Luther und der Frühreformation fortgeführt und radikalisiert wird. […] Völlig umsonst werden wir selig. Luther vollzieht also den Quantensprung vom Minimum zum Nichts“ (359). Hamm sieht in den von ihm vorgestellten Antriebskräften Kohärenzen zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert und zugleich eine „religiöse Revolution“ (365) in der „Sprengkraft der Reformationsdynamik“ (365).
Diese inhaltliche Dynamik macht seine gut verständliche Darstellung geradezu spannend zu lesen. Gelegentliche Redundanzen hat der Autor bewusst beibehalten, so dass jedes Kapitel eigenständig ist und die Kapitel in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können. In Kap. 14 (461–497) sowie im deutschen und englischen Schlusswort (498–513) bündelt Hamm seine Ausführungen unter seiner Ausgangsthese: „Herkunft aus dem Spätmittelalter und innovative Eigendynamik“ (473). Ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis (515–556) sowie ein Personen-, Orts- und Sachregister (557–591) beschließen das Werk.
Hier liegt die Frucht langjährigen Forschens des Autors vor. Entsprechend lässt die Arbeit auch die eigene Bibliographie durchscheinen, von Hamms frühen Arbeiten zu Johannes von Paltz bis zur Konzentration auf die lutherische Reformation oder die Reichsstadt Ulm. Diesen Fokus auf die lutherische und reichsstädtische Reformation könnte man kritisieren, vielleicht auch, dass neuere englischsprachige Forschungen zur Reformation zu kurz kommen. Doch damit wäre der Darstellung unrecht getan: Sie ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit (IX) eine umfassende und facettenreiche, profunde und zugleich thesenstarke Darstellung der religiösen Antriebskräfte zwischen 1380 und 1520, und auch wer nicht alle Thesen des Autors zu teilen vermag, wird Gewinn aus der Lektüre ziehen!
Dr. Ulrike Treusch, Professorin für Historische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen