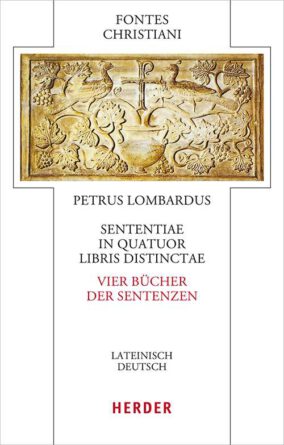Petrus Lombardus: Sententiae in quatuor libris distinctae
Petrus Lombardus: Sententiae in quatuor libris distinctae – Vier Bücher der Sentenzen, lat. – dt., Fontes Christiani Sonderband, eingel., übers. u. kommentiert von Stephan Ernst, Freiburg/Basel/Wien: Herder, 2024, geb., 1961 S., € 158,–, ISBN 978-3-451-32943-2
Bevor Martin Luther zum Doktor der Theologie promoviert wurde, wurde ihm am 9. März 1509 an der Wittenberger Universität der Grad des baccalaureus biblicus verliehen. Vom Herbst an musste er in Erfurt als baccalaureus sententiarius eine kommentierende Vorlesung über das grundlegende dogmatische Werk der theologischen Ausbildung seiner Zeit halten, über die Sentenzen des Petrus Lombardus. Erst diese Tätigkeit berechtigte ihn, sich um die Licentia magistrandi zu bewerben, die er einige Tage vor seiner Promovierung zum Doktor der Theologie im Oktober 1512 erhielt (vgl. Sentenzen Einl., 11; K. Aland, Hilfsbuch, Nr. 565 zum Text WA 9, 29–94 mit Einl. von Georg Buchwald 28f; M. Brecht, Luther 1, 98–101; s. auch TRE 26, 301, 41–44).
Die Sentenzen des Lombarden sind nicht das einzige theologische Werk, das Luther durchgearbeitet hat. Es war jedoch für seine spätere Tätigkeit als Theologieprofessor so wichtig, dass er es immer wieder zitiert hat. Im Register der Weimarer Lutherausgabe wird an annähernd 200 Stellen auf Petrus Lombardus verwiesen. Sechsundfünfzig beziehen sich auf die Vorlesung, an weiteren 123 Stellen geht Luther in anderen Zusammenhängen auf die Sentenzen ein. Gelegentlich rühmt Luther die hohe Gelehrsamkeit und Belesenheit des Petrus, der mit seinen aus vielen Kirchenvätern zusammengestellten Exzerpten die Veröffentlichung weiterer theologischer Bücher zwar verhindern wollte, aber nicht konnte. Bekannt ist eine längere Stellungnahme von Luther in den Tischreden, die folgendermaßen beginnt (WATR 3, 543, Z. 12–17, Nr. 3698 dt. Text): „Magister sententiarum, der Meister von hohen Sinnen [= klug], Petrus Lombardus, ist ein sehr fleißiger Mann und eines hohen Verstandes gewesen, hat viel fürtrefflichs Dings geschrieben. Er wäre furwahr ein großer fürnehmer Doctor der Kirchen gewesen, wenn er sich ganz und gar mit Ernste hätte auf die heilige Schrift gegeben. Aber er hat sein Buch mit vielen unnützen Fragestücken verwirret …“ Daran schließt sich eine allgemeine Kritik des Verhältnisses von Gesetz und Gnade bei den Scholastikern an, die weder den Sündenfall noch den geistlichen Charakter des Gesetzes, das vollkommenen Gehorsam fordert, verstanden hätten (ebd. 543, Z. 18–25).
Das Beispiel aus Luthers Lebenslauf zeigt, wie die Auslegung der Sentenzen vom Beginn des 13. Jahrhunderts bis in seine Zeit selbstverständlicher Teil der Ausbildung auf dem Weg zur Professur war. Im Urteil heutiger Historiker sind die Sentenzen „die erfolgreichste Sammlung theologischer Fragestellungen des 12. Jahrhunderts“ und „der wichtigste theologische Text des Mittelalters“ (Stephen F. Brown, LThK³ 8, Sp. 128f). Stephan Ernst, Herausgeber des Fontes-Christiani-Sonderbandes, urteilt, die vier Bücher seien: „eine der ersten umfassenden systematischen Gesamtdarstellungen (Summen) der Theologie, in der alle zentralen Glaubensinhalte in diskursiver und konsistenter Weise dargestellt und ausgelegt werden“ (7, vgl. Einl., 10). Die Summa theologiae des Thomas von Aquin hat, beeinflusst von den Jesuiten, erst im 16 Jh. die Sentenzen des Lombarden abgelöst.
Petrus Lombardus’ (um 1100–1160) vier Sentenzenbücher entstanden aus seiner Pariser Lehrtätigkeit und für den Unterricht des theologischen Lehrers zwischen den Jahren 1155 und 1158 (LThK³ 8, Sp. 128). Der Verfasser greift besonders häufig auf Texte des Kirchenvaters Augustinus zurück, wertet aber auch Hilarius von Poitiers, Ambrosius und Johannes von Damaskus sowie vieler anderer Quellentexte aus (Einl., 20f). In seinem Vorgehen wendet Petrus Lombardus die dialektische Methode Abaelards konsequent an (12, vgl. https://www.abaelard.de/050503sicnond.htm Stand: 20.9.2025). Petrus ist eher zurückhaltend gegenüber weltlich-philosophischen Erkenntnissen; er sieht einen Widerspruch zwischen der Wahrheit des Glaubens, die nicht aus der Erfahrung des Menschen mit der Welt und sich selbst kommt, sondern aus dem Hören auf die Offenbarung in Gottes Wort (23f, s. „Aufer argumenta, ubi fides quaeritur … Piscatoribus creditur, non dialecticis“ 1274, dt. 1275).
Methodisch geht Petrus Lombardus so vor, dass er ein – eventuell vorstrukturiertes Thema – voranstellt. Diese These wird weiter entweder lehrmäßig erläutert oder durch Bibelzitate, Kirchenväterexzerpte oder Vernunftgründe problematisiert. Der dritte methodische Schritt besteht in der Auflösung der scheinbaren Widersprüche, wobei Petrus einige Konkordanzregeln anwendet, die Peter Abaelard im Prolog zu Sic et non formuliert hat. Dies führt viertens zu einer Auflösung (solutio) oder zur Entscheidung (determinatio) über das theologische Problem. In den nachstehenden Distinciones werden weitere Einzelfragen, die sachlich zum Thema gehören, behandelt (26).
Die Sentenzen sind in vier Teile geteilt (vier „Bücher“ 29f). Ausgehend von der Bibel, die er immer wieder gelesen hat, beginnt das Werk im ersten Buch mit der Lehre von der Dreieinigkeit und den Eigenschaften Gottes (152–660). Das zweite Buch widmet sich der Schöpfungslehre und dem Sündenfall (661–1097). Im dritten Buch wird die Christologie behandelt (1098–1425). Das Gesamtwerk schließt mit dem vierten Buch über die sieben Sakramente und die Letzten Dinge (1426–1935). Die vier Bücher sind insgesamt in 182 Distinktionen oder – ebenfalls insgesamt – in 933 Einzelfragen („Kapitel“) unterteilt.
Im Rahmen des vorgegebenen Rezensionen-Umfangs von rund 1.000 Wörtern kann ein so umfangreiches Werk auch nicht annähernd adäquat vorgestellt werden. Einige Hinweise auf den Inhalt mögen im Folgenden genügen, um das Leseinteresse zu wecken. Nach dem Prolog (64–67) enthält das Lehrbuch ein detailliertes zweisprachiges Kapitelverzeichnis (68–151), das sowohl ein (selbstverständlich vorhandenes, 5–6) Inhaltsverzeichnis als auch ein Sachregister als unnötig erscheinen lässt.
Für „typisch scholastisch“ hält der evangelische Theologe mit begrenzten Mittelalterkenntnissen den Umstand, dass neben den wichtigen dogmatischen Standardthemen aus seiner Perspektive überspitzte, unnötige oder nicht beantwortbare Fragen gleichfalls behandelt werden. Zu dieser Kategorie zählt wahrscheinlich die Frage „Wo Gott war, bevor es die Schöpfung gab“ (Buch 1, XXXVII, Kap. 166), während die Überlegung „Ob wir die Leiden der Heiligen wollen sollen (Buch 1, XLVIII, Kap. 210) wahrscheinlich unter „typisch katholisch“ abgelegt wird. Das oft als „typisch scholastisch“ zitierte Problem, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen, wird bei Petrus Lombardus nicht verhandelt. Für alle Konfessionen interessant dürfte dagegen sein, wie Petrus Lombardus die Erschaffung der Frau aus der Seite Adams deutet (sie steht an seiner Seite, nicht über oder unter ihm, Buch 2, XVIII, Kap 103–109). Der Inhalt von Distinktion XXVIII (Kap. 181–184) „Über die pelagianische Irrlehre“ weist schon auf die zu Unrecht so genannte „evangelische“ Gnadenlehre hin.
Im 4. Buch werden in den Distinktionen II bis VI, Kap. 12 bis 42 über den Themenkreis Taufe unter anderem die Fragen behandelt, wievielmal der Täufling untergetaucht werden soll (ein- oder dreimal, III, Kap. 23); was eine Scherz-Taufe zur gültigen Taufe macht (die rechte Intention, VI, Kap. 40); wie das Reinigungsfeuer (ignis purgatorium, XXI, Kap. 118) zu verstehen ist und wie Katechese und Exorzismus der Taufe zugeordnet sind (K. u. E. vor der Taufe, VI, Kap. 42). – Unter den zahlreichen Anweisungen zur Ehe findet sich im 4. Buch ein Abschnitt über das Alter, in dem die Ehe geschlossen werden kann; es liegt für Jungen bei 14, für Mädchen bei 12 Jahren (XXXVI, Kap. 211). Auch die seelsorgerlich wichtigen Fragen der Kindstötung im Mutterleib und das Schicksal von Fehlgeburten und der Geburt lebensunfähiger Behinderter werden behandelt (XXXI, Kap. 184, 185; XLIV, Kap. 258).
Die Vielfalt von keineswegs veralteten, sondern oft sehr aktuell wirkenden dogmatischen und ethisch-seelsorgerlichen Fragen machen die Sentenzen zu einer gewinnbringenden Lektüre auch für evangelische Hauptamtliche in Gemeinde und Hochschule. Für die außerordentliche Leistung beim Übersetzen, Kommentieren und Edieren der Sentenzen gebührt dem Herausgeber Stefan Ernst von der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Würzburg außerordentlicher Dank!
Pfarrer Dr. Jochen Eber, Schriesheim