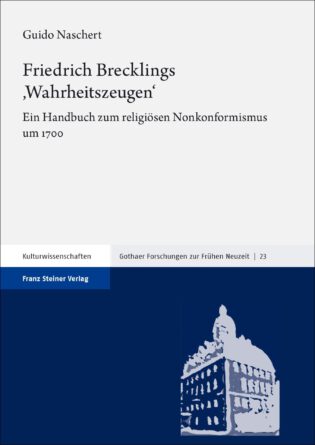Guido Naschert: Friedrich Brecklings ,Wahrheitszeugen‘
Guido Naschert: Friedrich Brecklings ,Wahrheitszeugen‘. Ein Handbuch zum religiösen Nonkonformismus um 1700, Gothaer Forschungen zur Frühen Neuzeit 23, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2024, 320 S., € 64,– ISBN 978-3-515-13215-2.
Man kann den hier zu besprechenden Band in eine Reihe zu dem von J. A. Steiger herausgegebenen Tagebuch Friedrich Brecklings „Autobiographie. Ein frühneuzeitliches Ego-dokument“ (s. meine Rezension in JETh 22, 2008, 338–340) setzen, fördert sie doch in noch anderer Weise das Netzwerk des holsteinischen Nonkonformisten, der den allergrößten Teil seines Lebens in den Niederlanden verbrachte, zutage. Der Untertitel der Arbeit ist völlig einsichtig. Es geht längst nicht nur um eine schillernde Person aus der Zeit „um 1700“, sondern der Band ist eine Fundgrube bei der Suche nach Namen und Personen, die in keinem Lexikon auftauchen. Die Liste in Teil I umfasst sage und schreibe 1078 Personen, teilweise mit Kurzcharakterisierungen. Sie ergänzt die Liste der „Wahrheitszeugen“, die Breckling Gottfried Arnold für seine „Unpartheiische Kirchen- und Ketzerhistorie“ zur Verfügung gestellt hatte, um ein Mehrfaches. Dieser Teil I (9–169) gliedert sich in zwei große Abschnitte. Im ersten wird das „alphabetisch nach deutschen, niederländischen und skandinavischen Städten und Gebieten geordnete Verzeichnis von Personen“ linksseitig als Faksimile des in der Forschungsbibliothek Gotha aufbewahrten Originals wiedergegeben, während auf der rechten Seite die jeweilige Transkription in der Weise erfolgt, dass Einrückungen, Absätze, Streichungen und dergleichen genau an die Vorlage angepasst werden. Wie schon der Titel dieses Verzeichnisses zeigt, folgt die Ordnung einer geographischen Gliederung. Im zweiten Abschnitt werden dann alle vorkommenden Namen alphabetisch aufgelistet und mit einem unterschiedlich langen Biogramm versehen, das zusätzlich auch Kontakte zu anderen im Verzeichnis vorkommenden Personen notiert. Es wird also ein weites Netz gespannt, das für jeden, der in diesem Zeitraum forscht, eine Fundgrube darstellt. Diese Vernetzung verweist selbstverständlich auf unterschiedliche vorliegende und in Bearbeitung begriffenen Forschungsarbeiten. So wird etwa immer wieder auf die (biographischen) Forschungsergebnisse der Spenerbriefausgabe hingewiesen (www.edition-spenerbriefe.de ), wie umgekehrt Erkenntnisse aus dem hier vorgelegten Verzeichnis helfen (und geholfen haben), in der Briefausgabe genannte Personen zu identifizieren. Die Belege in den Kurzbiogrammen im vorliegenden Band sind freilich nicht immer konsistent und lassen Fragen zu. So wird häufig auf die alten Lexika von Zedler und Jöcher verwiesen, wo schon neuere Literatur oder neuere Lexikonartikel vorliegen. Manchmal wird auf die neuesten theologischen Lexika (TRE, RGG4) hingewiesen, manchmal werden sie übergangen. Gleiches gilt für Pfarrerbücher, die nicht konsequent befragt werden (Beispiel: Bei „Marcus Antonius Schmidt“ wird lediglich die von Breckling vorgenommene Beurteilung „optimus“ und der Ortsname „Tochov“ angegeben, während er als Pfarrer von Tychow sehr leicht nach dem pommerschen Pfarrerbuch hätte identifiziert werden können). Die Ausgabe der Briefe Speners aus der Dresdner Zeit (die Angabe fehlt in der Bibliographie) wird nicht konsequent für die Identifizierung von Personen herangezogen (Beispiel: die aus Frankfurt nach Pommern gekommene „Lisbeth“ [132] war mit dem Pfarrer Philipp Christoph Zeise [167] verheiratet, wie man aus Spener, Dresdner Briefe, Bd. 3, 169, leicht hätte ersehen können; weitere Beispiele könnten folgen). Diese Beobachtungen mögen aber den Wert der Edition des Gothaer Faszikels nicht zu verdunkeln.
Das erstaunlich große Netzwerk an Bekannten und/oder Korrespondenten Brecklings wird nicht zuletzt durch das in Teil IV vorgelegte Kartenmaterial erkennbar, mit dem die Personen- und Ortsnamen visuell dargestellt werden. Dabei wird ersichtlich, dass die von ihm gelegentlich als „optimi“ bezeichneten „Wahrheitszeugen“ ebenso wie seine Korrespondenzpartner vermehrt in jenen Gegenden des Alten Reiches zu finden sind, in denen „Pietisten“ wirkten (Herzogtum Magdeburg mit Harzgegend, Hamburg und Hinterpommern), freilich ohne Breckling selbst damit unter diese subsumieren zu können. Bemerkenswert ist aber, dass in der Zeit, in der die in Teil I veröffentlichte Liste entstand (ca. 1690 bis 1700; s. 249), kaum Kontakte in das für den Pietismus später so wichtig werdende Württemberg bestanden (270) (Elias Veiel in Ulm ausgenommen, dazu im Zusammenhang anderer „Nonkonformisten“ wie etwa J. G. Gichtel, 267). Dieser Befund entspricht durchaus auch dem der Spenerbriefe. Die lokalen Schwerpunkte der pietistischen bis nonkonformistischen Frömmigkeit lagen in dieser Zeit deutlich im norddeutschen und nordostdeutschen Gebiet.
Teil II des vorliegenden Bandes publiziert eine lange Bücherliste Brecklings (171–230), die dieser mit „Bibliotheca Bibliothekarum“ (sic!) überschrieben hat. Anders als in Teil I wird lediglich exemplarisch eine Seite der Handschrift als Faksimile abgedruckt. Die anderen werden nur in transkribierter Form aufgelistet, wobei exakt die von Breckling verwendete Form der Titelangabe wiedergegeben wird – abgekürzt und häufig, aber längst nicht durchgängig, mit Angabe von Ort und Jahr. Die Liste scheint eine Vorarbeit für ein nie realisiertes Publikationsprojekt zu sein, das vergleichbaren Zusammenstellungen mit dem Titel „Bibliotheca“ entsprach. Der Katalog umfasst ca. 2.000 Titel (252). Nach Naschert gibt sie „einen spezifischen Einblick in das literarhistorische Wissen des dissidenten Milieus um 1700“ (252). Ob man eine solche Verallgemeinerung von einer – gelehrten – Einzelperson auf ein ganzes Milieu machen kann, muss die weitere Forschung erst noch erweisen. Jedenfalls steht aber fest, dass Breckling mit seiner „enzyklopädischen Bücherkenntnis“ sich keineswegs von der „akademischen Buchgelehrsamkeit“ abgekehrt hat (251), wie dies bei einigen radikalen Pietisten wahrzunehmen ist. In welchem Verhältnis diese Liste zu seinem eigenen Bücherbesitz steht, ist nicht völlig klar. Allerdings wird Brecklings Bibliothek von Gottlieb Stolle, der ihn auf der Durchreise in Amsterdam besuchte, als „die beßte connoissance von allen Secten und paradoxen Leuthen in Holland, Engelland und Deutschland“ gelobt (252). Schon eine schnelle Durchsicht macht deutlich, dass Breckling umfangreich auf patristische und mittelalterliche Literatur, bei letzterer keineswegs nur auf Mystiker, die man erwarten könnte, verweist. Exemplarisch sei hier auf Ubertin von Casales „Arbor vitae“ verwiesen (193), das eine bedeutende Wirkmächtigkeit in der Apokalypseauslegung entfaltete, ebenso auf Joachim von Fiore (193). Keineswegs ist diese Bibliothek auf theologische oder „fromme“ Literatur beschränkt, sondern enthält naturwissenschaftliche (J. Kepler; R. Bacon u.a.m.), historische, geographische (J. Acosta, Historia Americana) juristische und – auffallend häufig – medizinische Bücher. Eine genauere Untersuchung über die prozentuale Häufigkeit, wie dies von B. Klosterberg für die Sammlung vorgenommen wurde, die Breckling der Bibliothek des Halleschen Waisenhauses schenkte (B. Klosterberg, Libri Brecklingici, in: Interdisziplinäre Pietismusforschungen, hg. von U. Sträter, Halle a. S. 2005, 871–881), wäre für die vorliegende Liste eine hilfreiche Ergänzung gewesen. Eine exakte Bibliographierung der einzelnen Titel wäre zwar wünschenswert, aber arbeitsökonomisch wohl unverhältnismäßig gewesen. Selbstverständlich sind, wie die Beschreibung Stolles zusammenfassend zeigt, die „Secten“ wie etwa die Labadisten, Vertreter des „linken Flügels der Reformation“ (Sebastian Franck u.a.), fromme Einzelpersonen des 17. Jds. (Abraham von Franckenberg u. a.) und dergleichen vertreten. Zu den Vorläufern der pietistischen Bewegung, die von Breckling genannt werden, zählt selbstverständlich auch Johann Arndt. Darüber hinaus fällt auf, dass reichlich Vertreter der lutherischen Orthodoxie genannt sind (Brecklings Lehrer Johann Conrad Dannhauer und Sebastian Schmidt, Johann Gerhard, Salomon Glassius, der dänische Theologe Jesper Brochmand, aber auch die späteren Pietismusgegner Philipp Ludwig Hanneken und Samuel Schelwig). Dem gegenüber sind zu erwartende Namen wie Philipp Jakob Spener, mit dem Breckling jahrzehntelang korrespondierte und der den in ökonomisch prekären Verhältnissen lebenden Briefpartner finanziell unterstützte, und Joachim Justus Breithaupt nur ganz spärlich vertreten. Eine genauere Auswertung der vorgelegten Liste unter der Fragestellung nach der Einordnung Brecklings in die theologischen und frömmigkeitsgeschichtlichen Auseinandersetzungen der Zeit um 1700 steht noch aus.
Der III. Teil ist Brecklings Netzwerk gewidmet (230–273), das unter verschiedenen Aspekten (z. B. „Buchhändler und Drucker“, 270–272) behandelt wird. Der Vergleich mit anderen, der Forschungsöffentlichkeit schon vorgelegten Netzwerkbeschreibungen bestätigt den o. g. Befund einer eher spärlich vorhandenen Vernetzung mit den Gegenden, in denen die pietistische Bewegung in den 1690er Jahren vornehmlich beheimatet war (Thüringer und Magdeburger Raum; Nordostdeutschland; 269f). Der Vollständigkeit halber sei noch auf die Teile IV bis VII verwiesen, die das schon erwähnte Kartenmaterial, eine Zeittafel, editorische Bemerkungen und ein ausführliches Nachlass-, Quellen- und Literaturverzeichnis bieten.
All dies lässt die Funktion des Buches erkennen, das „als Hilfsmittel zum Verständnis von Friedrich Brecklings Menschen- und Bücherkenntnis gedacht (ist)“ und es „ermöglicht (…) künftig, sein ‚Netzwerk‘ mit anderen Netzwerken besser abzugleichen“ (272). Es handelt sich um einen wichtigen – noch nicht vollständig behauenen – Baustein der Erforschung der Frömmigkeit auf der Schwelle vom 17. zum 18. Jahrhundert, der aller Beachtung wert ist.
Dr. Klaus vom Orde, Halle (Saale)