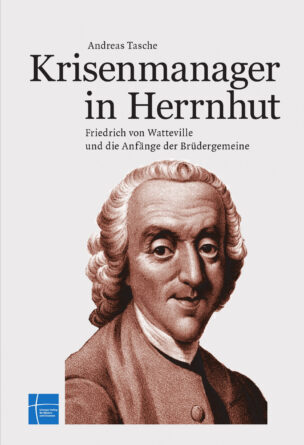Andreas Tasche: Krisenmanager in Herrnhut
Andreas Tasche: Krisenmanager in Herrnhut. Friedrich von Watteville und die Anfänge der Brüdergemeine, Neuendettelsau: Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, 2024, Pb., 278 S., € 22,90, ISBN 978-3-87214-585-7
Das vorliegende Buch des früheren Herrnhuter Pfarrers Andreas Tasche schließt eine Forschungslücke. Obwohl Friedrich Freiherr von Watteville (1700–1770) mehrere Jahrzehnte lang einer der bedeutendsten Mitarbeiter Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorfs war, des Gründers der Herrnhuter Brüdergemeine, ist er in der Öffentlichkeit kaum bekannt und liegt die einzige existierende größere Arbeit über sein Wirken mittlerweile mehr als 100 Jahre zurück: eine Dissertation von Johannes Grosse, Studien über Friedrich von Watteville. Ein Beitrag zur Geschichte des Herrnhutertums, Halle (Saale), 1914. Tasches Buch zeigt, dass die Brüdergemeine von Anfang an keine Zinzendorf-Gemeinde war. Neben dem Grafen war zu allen Zeiten eine größere Anzahl sowohl von Männern als auch von Frauen an ihrem Aufbau und Fortgang maßgeblich beteiligt. Eine der großen Fähigkeiten Zinzendorfs bestand darin, außergewöhnlich begabte und einsatzfreudige Männer und Frauen für den Dienst in der Brüdergemeine zu gewinnen. Das sollte bei aller (notwendigen) Kritik an seinem oft schwierigen Umgang mit seinen Mitarbeitern nicht vergessen werden.
Keiner von ihnen lebte und wirkte so lange an der Seite Zinzendorfs wie der Berner Patriziersohn und Bankier Watteville, der bereits zu den Mitschülern des Grafen auf dem Pädagogium Regium August Hermann Franckes in Halle gehört hatte. Ihre Verbundenheit reichte schon damals über das normale Mitschülersein insofern hinaus, als Watteville zum sog. Senfkornorden gehörte, einer von Zinzendorf gestifteten Gemeinschaft von Jugendlichen, die sich noch in den Franckeschen Stiftungen zum Engagement für den Bau des Reiches Gottes zusammengeschlossen und verpflichtet hatte.
Dennoch war es alles andere als selbstverständlich, dass Watteville einer der langjährigen leitenden Mitarbeiter des entstehenden Herrnhut wurde. Nach der gemeinsamen Schulzeit hatte sich der Lebensweg von Zinzendorf und Watteville nämlich zunächst getrennt. Watteville war in die väterliche Bank eingestiegen und hatte diese zu höchster Blüte geführt. Der vielfache Millionär war jedoch durch den plötzlichen Zusammenbruch der väterlichen Bank in Paris wirtschaftlich in den Ruin geraten, und hatte auch in seelischer Hinsicht Schaden genommen. Zusammen mit dem Lebensmut war ihm der christliche Glaube abhandengekommen. Indem ihn Zinzendorf dauerhaft an die im Aufbau befindliche und sehr bald weltweit expandierende Brüdergemeine zu binden verstand, konnte Watteville seine Lebenskrise überwinden, fand neuen Lebenssinn und auch wieder zum Glauben zurück.
Das vorliegende Buch ist aus den Quellen gearbeitet, von denen es sogar eine Reihe bisher unbekannter erschließt. Auch in äußerer Hinsicht ist es ansprechend gestaltet: So enthält es eine Vielzahl von (z. T. weniger bekannten) Abbildungen und neben einem ausführlichen Literaturverzeichnis ein weiterführendes Register der Orts- und Personennamen. Zur Orientierung hilfreich sind auch die beiden Beigaben über die Watteville-Nachkommen und über die vielfältigen Ämter, die er während seiner Tätigkeit im Rahmen der Brüdergemeine ausgeübt hat. Gerade die Aufstellung über die Nachkommen ist erhellend, um die verschiedenen verwandtschaftlichen Verhältnisse zwischen den Familien Watteville und Zinzendorf entwirren zu können. War doch ein Neffe Wattevilles, der Sohn seines zweitältesten Bruders, mit der jüngsten Tochter Zinzendorfs, Elisabeth, verheiratet und hat Watteville den späteren Schwiegersohn Zinzendorfs, Johann von Watteville, geb. Johann Michael Langguth, adoptiert, damit dieser die älteste Tochter des Grafen Zinzendorf, Henriette Benigna Justine, heiraten konnte.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch, eine ausführliche Biographie Wattevilles zu sein, sondern legt den Schwerpunkt auf die ersten Jahrzehnte seines Wirkens nach der Gründung Herrnhuts im Jahr 1722. Es ist in 14 ungleich lange und auch in inhaltlicher Hinsicht unterschiedlich gewichtige Kapitel untergliedert. Ohne die Kapitel hier im Einzelnen alle nennen zu können: Es gelingt dem Verfasser darin, einen weiten Bogen von der Vorgeschichte Wattevilles bis zu dessen letzten Jahren und Vermächtnis zu spannen.
Einen Beleg für Zinzendorfs seelsorgliche Fähigkeiten stellt die Darstellung des komplizierten Weges von Wattevilles nach Herrnhut dar und vor allem der Umstände, die zu seiner Entscheidung für ein dauerhaftes Engagement in der Brüdergemeine führten (Kap. 2 und 3). Tasche hat recht, wenn er in Watteville neben Zinzendorf den zweiten „Stifter“ der Brüdergemeine sieht (Kap. 4 und 5). Während der Graf als Visionär wesentlich die Wege der Gemeinde und ihre weltweite Expansion bestimmte und zeitlebens im öffentlichen Rampenlicht stand, verkörperte Watteville das stabile Element im Hintergrund. Ohne seine organisatorischen Fähigkeiten, seine Begabung, zwischen Konfliktpartnern zu vermitteln (Tasche nennt ihn „Zinzendorfs Krisenmanager“), und vor allem seinen Sachverstand in finanziellen Angelegenheiten hätte die Brüdergemeine nicht überlebt. Er bewährte sich dabei auch als Berater der Gräfin Erdmuthe von Zinzendorf (Kap. 12), die in den ersten Jahrzehnten Herrnhuts so etwas wie die Finanzdezernentin der Brüdergemeine mit ihren weit ausgreifenden missionarischen Aktivitäten war.
Hervorheben möchte ich auch das Kapitel 6, in dem es um die Ehe Wattevilles mit Johanna Sophia von Zezschwitz geht. Von Haus aus pietistisch geprägt, gehörte sie zusammen mit ihren beiden Schwestern neben – in mancher Hinsicht sogar vor – der Ehefrau Zinzendorfs zu den ersten einer Reihe von hochbegabten, vermögenden Frauen, die ihr Leben unter der Anleitung Zinzendorfs im Rahmen der Brüdergemeine eigenverantwortlich in den Dienst für Jesus stellten. So ist ihr – noch vor dem Eheschluss mit Watteville – die Gründung der ersten Mädchenschule in Berthelsdorf, dem ursprünglichen Hauptort der Güter des Grafen, zu verdanken. Sie ließ das dafür nötige Schulgebäude aus eigenen Mitteln erbauen. Das Ehepaar Watteville führte wie die Zinzendorfs eine „Streiterehe“, setzte sich gemeinsam für die Belange des Reiches Gottes ein und war dabei immer wieder bereit, dafür auch Teile ihres Privatvermögens zur Verfügung zu stellen. Nach der Darstellung Tasches müssen sie sich von ihrem Charakter her gut ergänzt haben: Während Watteville Zeit seines Lebens unter Minderwertigkeitsgefühlen litt, war Johanna Sophia offensichtlich eine zupackende Frau. Von den sechs Kindern erreichte nur eine Tochter das Erwachsenenalter, die mit ihrem Mann, Heinrich von Bruiningk, der später u. a. auch Bischof wurde, im Dienst der Brüdergemeine stand.
Bemerkenswert ist ebenso das kürzere Kapitel 10 über Watteville als Dichter. Es ist Zinzendorf, einer der großen Lyriker der evangelischen Christenheit, ähnlich wie Luther darum gegangen, die Mitglieder der Brüdergemeine zu eigenen geistlichen Gedichten anzuregen. Auch wenn Watteville nur in bescheidenem Umfang als Lieddichter tätig war, scheinen bis zum vorletzten, 1967 erschienen, Gesangbuch der Brüdergemeine immer Lieder von ihm enthalten gewesen zu sein.
Im Kapitel 11 „Spätere eigenständige Missionen“ wird deutlich, dass Watteville auch weit über Herrnhut hinausreichende Aufgaben im Rahmen der Brüdergemeine übernahm. Zwar besuchte er nicht wie Zinzendorf die amerikanischen Niederlassungen der Brüdergemeine, dafür wurde er aber von diesem mit schwierigen diplomatischen Missionen in Europa beauftragt. Über ihn konnte Zinzendorf den Kontakt zum Pariser Kardinal Louis-Antoine de Noailles aufrechterhalten, den er bei seiner Kavaliersreise kennen- und schätzen gelernt hatte. Watteville kamen dabei seine exzellenten Französischkenntnisse zugute. Er war auch der Initiator der ersten fremdsprachigen Ausgabe des Losungsbuches überhaupt, die 1741 auf Französisch erschien. Watteville ist zu verdanken, dass die Brüdergemeine in Zeist in den Niederlanden dauerhaft Fuß fassen konnte, obwohl die erste Ansiedlung Herrendijk bei Ijsselstein wieder aufgegeben werden musste. Schließlich sei hier noch auf seinen entscheidenden Anteil am positiven Ausgang der Verhandlungen zwischen der Brüder-Unität und dem sächsischen Staat hingewiesen. Durch die Gewährung zweier großer Darlehen an Sachsen wurde es möglich, dass der Graf nach über 10 Jahren Verbannung 1747 dauerhaft nach Herrnhut zurückkehren konnte. Gleichzeitig bestätigte eine „Königlich-sächsische Untersuchungskommission“, dass die Brüdergemeine trotz ihrer besonderen liturgischen Formen und Gemeindeämter innerhalb der sächsischen lutherischen Staatskirche verbleiben durfte.
Tasche will sich in seinem Buch nach eigenen Worten auf das Wirken Wattevilles in den Anfangsjahren Herrnhuts beschränken. Beim genaueren Hinsehen zeigt sich allerdings, dass er immer wieder dessen Tätigkeit während seines ganzen Lebens in den Blick genommen hat. Ein Problem stellt in meinen Augen die philadelphische Deutung des Herrnhuter Experiments dar. Tasche hat sich hier der These Paul Peuckers aus dessen Buch Herrnhut 1722–1732 (Göttingen 2021) angeschlossen, eine Auffassung, die in der Vergangenheit zwar immer wieder vertreten wurde, sich aber nicht durchsetzen konnte. Im Moment wird sie von einem Großteil der Zinzendorf-Forschung geteilt. Ich bin weiterhin anderer Meinung. Zinzendorfs hat die traditionelle lutherische Ekklesiologie seiner Zeit zwar weiterentwickelt. Aber genauso übernahm er nicht einfach philadelphische Gedanken, sondern unterzog sie einer Transformation. In seiner ganz eigenständigen Ekklesiologie verband er lutherische, philadelphische, pietistische, mystische u. a. Ansätze. Folgende Charakteristika zeichnen diese aus: Der Graf ist überzeugt, dass zum Christsein die Überwindung des Konfessionshasses gehört. Die Universalkirche darf auch nicht ausschließlich als eschatologische Größe gedacht werden. Damit verbunden ist eine Kritik an der Fokussierung lutherischer Ekklesiologie auf Ortsgemeinde und Territorialkirche. Stattdessen betont der Graf die beiden kirchlichen Sozialgestalten der Universalkirche und der Nachfolgegruppen, d. h. der Orden, wobei er sich um eine Reintegration dieser vierten Sozialgestalt der Kirche in die lutherische Ekklesiologie bemüht. Noch wichtiger als seine ökumenischen Bestrebungen war Zinzendorf zeitlebens sein missionarisches bzw. evangelistisches Engagement. Dankenswerterweise kommt das auch im vorliegenden Buch im Hinblick auf Wattevilles eigenes Wirken immer wieder zum Ausdruck – trotz der von Tasche vertretenen philadelphischen Interpretation des Herrnhuter Gemeindeexperiments.
Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig