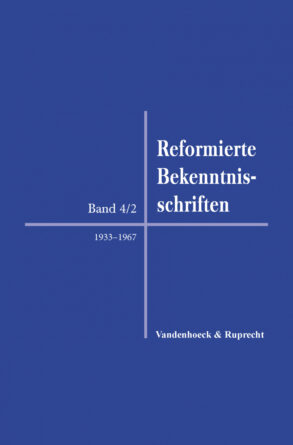Matthias Freudenberg / Andreas Mühling / Peter Opitz (Hg.): Reformierte Bekenntnisschriften
Matthias Freudenberg / Andreas Mühling / Peter Opitz (Hg.): Reformierte Bekenntnisschriften, Bd. 4/2: 1814–2019. Teilband 2: 1933–1967, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2025, Ln., VIII+384 S., € 99,–, ISBN 978-3-525-55468-5
Die reformierte Bekenntnisbildung war nie abgeschlossen. Auch der vorliegende Band 4/2 der Reformierten Bekenntnisschriften (RefBS) belegt diese deutliche Differenz zum Bekenntnisbegriff der Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche (BSELK), die lediglich neu herausgegeben werden (zuletzt 2014), die jedoch seit 1577 zehn an der Zahl geblieben sind.
Mit der Helvetischen Konsensusformel 1675 endete die Epoche inhaltlich streng altprotestantisch-orthodox formulierter reformierter Bekenntnisse (Teilband 3/2,2). Über das weitere Vorgehen hatte sich der ursprüngliche Herausgeberkreis um Heiner Faulenbach und Eberhard Busch bei Beginn der Edition noch nicht geeinigt (Bd. 1/1: 2002, 22, Anm. 61, vgl. 4/1, 5). Der erste Teilband von Band 4 hatte die neu einsetzende Bekenntnisentwicklung und Internationalisierung des 19. Jahrhunderts (und damit auch der Erweckungsbewegung) über Europa hinaus dokumentiert (4/1: 2022); Gegenstand des neusten Teilbandes 4/2 (2025) ist der Prozess aktuellen Bekennens im 20. Jahrhundert bis 1967.
Man kann es nicht oft genug hervorheben – und es ist auch immer wieder festgestellt worden –, dass die Barmer Theologische Erklärung (BTE, 1934) epochale Bedeutung für die Abfassung weiterer reformierter Bekenntnisse hatte („Ausgangspunkt für eine noch nicht abgeschlossene Phase neuer Bekenntnisbildung in den reformierten Kirchen“, 4/1, 4). Karl Barth betonte, es könne kein reformiertes „Weltbekenntnis“ geben, es müsse vielmehr ein konkreter Anlass für neues Bekennen gegeben sein (4/1, 4). So sind die neueren Bekenntnisse mit jeweils besonderem Inhalt, ausgelöst durch einen speziellen kirchlichen, gesellschaftlichen oder politischen Anlass, auf dem Hintergrund der weltweiten Ausbreitung reformierter Kirchen entstanden. „Die neueren Bekenntnisse seit 1933/1934 dokumentieren das aktuelle Bekennen einer Kirche vor Ort und haben ausdrücklich partikularen Charakter“ (4/1, 4). Kriterien zur Aufnahme in Teilband 4/2 der Auswahlausgabe reformierter Bekenntnisse sind wie bei den vorher veröffentlichten Texten deren kirchliche und öffentliche Approbation sowie ihr repräsentativer Charakter.
Drei Bekenntnistexte, die in der kirchlichen Notlage während des Dritten Reiches entstanden sind, bilden den Auftakt von insgesamt zwölf Dokumenten: Eine theologische Erklärung zur Gestalt der Kirche (Düsseldorfer Thesen) 1933 (Nr. 103, 1–9), Erklärung über das rechte Verständnis der reformatorischen Bekenntnisse in der Deutschen Evangelischen Kirche 1934 (Nr. 104, 11–25) und die bekannte Barmer Theologische Erklärung 1934 (Nr. 105, 27–38). – Die Düsseldorfer Thesen (Text: 7–9) hatten „eine erhebliche Wirkung“ (4) in den reformierten Gemeinden des Deutschen Reichs im Vorfeld der Bildung der staatlich gewollten neuen „Reichskirche“. – Die „Erklärung“ (Text: 17–25) vom Anfang des Jahres 1934 war inhaltlich mit der Ablehnung deutsch-christlicher Lehrmeinungen und auch im Aufbau der einzelnen Artikel im Bekennen der rechten und Verwerfen der falschen Lehre ein wichtiger Vorläufer der BTE. – Auf der ersten gemeinsamen Synode lutherischer, reformierter und unierter Kirchen in (Wuppertal-) Barmen wurde schließlich am 31. Mai 1934 die Barmer Theologische Erklärung (Text: 33–38) verabschiedet, die für den Aufbau einer „Bekennenden Kirche“ innerhalb der deutschen Reichskirche von hervorragender Bedeutung war.
Die Glaubenserklärung der Reformierten Kirche in Frankreich (ERF) 1938 (Nr. 106, 39–51) bezeugt die Vereinigung theologisch unterschiedlicher reformierter Kirchen zu einer Kirche, die 2013 mit der Evang.-Lutherischen Kirche eine Union zur Vereinigten Protestantischen Kirche in Frankreich eingingen (46f). – In den Thèses de Pomeyrol 1941 (Nr. 107, 53–75) artikulieren die Reformierten Frankreichs ihren Glauben angesichts der Bedrohung durch das totalitäre System der Hitler-Diktatur und der Judenverfolgung (These 7, 72, Z. 15–21).
Als Frucht der erstarkenden Ökumenischen Bewegung wird die erste Union bischöflicher und nicht-bischöflich verfasster Kirchen Südindiens in der Kirchengeschichte bis heute herausgestellt. Das umfangreiche wichtigste Dokument des Vereinigungsprozesses, Proposed Scheme of Church Union in South India, 1942 (Nr. 108, 77–208) ist für die Sammlung ausgesucht worden. Ein von alle Gemeinden akzeptiertes bischöfliches Amt wird unter der Bedingung angenommen, dass kein partikulares Verständnis des Bischofsamtes für alle verpflichtend gemacht werden dürfe (101–102 u. 122–123, 137–154; vgl. bes. 102, Z. 2 u. 23f u. 122, Z6–9). – Der Plan of Church Union in North India and Pakistan 1965 (Nr. 113, 281–335) ist maßgeblich von der südindischen Kirchenunion, aber noch mehr durch die Proposed Basis of Union von Kirchen in Ghana (Westafrika) beeinflusst (285). Aus europäischer Sicht ist erstaunlich, dass der Union mit Anglikanern auch baptistische, brüderische sowie methodistische Kirchen beigetreten sind und sich auch über Kindertaufe, Glaubenstaufe (308f u. d. baptistische Zusatzerklärung 334f) und Ämterordnung verständigen konnten.
Der Pastoralbrief Herderlijk schrijven van de Nererlandse Hervormde Kerk (Pastoral Letter of the Dutch Reformed Church) 1941 (Nr. 109, 209–232) dokumentiert die Bemühung der Nederlandse Hervormde Kerk, ihre kirchlich-theologische Existenz angesichts der nationalsozialistischen Bedrohung zu behaupten (Text: 223–232). Erstaunlich ist die Tatsache, dass das kurze Schreiben über eine Seite dem Thema Israel bzw. Kirche und Judentum widmet (229f). – Diese Tradition führt die theologische Erklärung der Niederländischen Generalsynode Fundamenten en Perspectieven van Belijden 1949 (Nr. 110, 233–253) fort, indem sie die bleibende Erwählung Israels betont (236 u. Abs. 17, 252).
Das kurze Glaubensbekenntnis der Kirche Christi in Japan 1953 (Nr. 111, 255–259) wird sowohl auf Japanisch (Transkription in lateinischer Schrift) als auch auf Deutsch abgedruckt (Text: 258f). – Das Statement of the Christian Faith 1956 (Nr. 112, 261–280) ist die letzte Bekenntnisschrift, die von der Presbyterian Church of England herausgegeben wurde. Es zählt zusammen mit dem Westminster Bekenntnis, der Savoy Declaration (beide: RefBS 3/2), der Declaration and Address des Thomas Campbell (1809) und der Declaration of Faith (1967) zum Bekenntnisstand der United Reformed Church of England and Wales. Ein ausführlicher Abschnitt des Statements befasst sich mit Social Order (Abs. VI, 278f). – Den Band 4/2 der Reihe Reformierte Bekenntnisschriften beschließt ein Bekenntnis der United Presbyterian Church in the U.S.A. von 1967 (The Confession of 1967, Nr. 114, 337–376). Christologie und Eschatologie des Textes sind von der Allversöhnungslehre geprägt (Teil I.A.1 u. Teil III). Aus der Versöhnung des Menschen in Christus werden gesellschaftspolitische Folgerungen gezogen, die eine optimistische Anthropologie der Machbarkeit des Guten widerspiegeln (II.A.4. u. III). Man könnte kritisch zurückfragen, ob hier nicht die alte Forderung von Augustinus an Pelagius wiederkehren müsste, die Konsequenzen des umfassend verstandenen Sündenfalls für den Zustand der Welt und in der Lehre vom doppelten Weltausgang zu bedenken.
Der vorliegende Band 4/2 zeigt , wie sich die ökumenische Verpflichtung, Kirchentrennungen nicht als historisches Schicksal zu sehen, positiv in einer wachsenden Zahl unierter Bekenntnisse ausgewirkt hat. Deshalb – und nicht nur aus diesem Grund – ist es richtig, die Reihe bis in die Gegenwart fortzusetzen. Hierbei zeigt sich, „… dass reformierte Kirchen in aller Welt die ursprünglich in den europäischen reformierten Kirchen geprägte Verpflichtung zum erneuten Bekennen bei neuer Einsicht innovativ aufgreifen“ (RefBS 4/1, 6).
Pfarrer Dr. Jochen Eber, Schriesheim