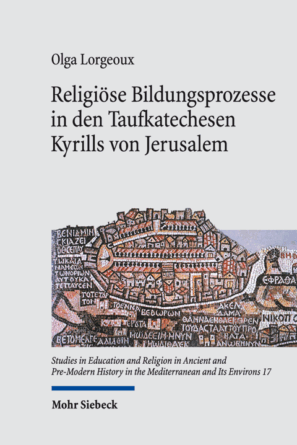Olga Lorgeoux: Religiöse Bildungsprozesse in den Taufkatechesen Kyrills von Jerusalem
Olga Lorgeoux: Religiöse Bildungsprozesse in den Taufkatechesen Kyrills von Jerusalem, Studies in Education and Religion in Ancient and Pre-Modern History in the Mediterranean and Its Environs 17, Tübingen: Mohr Siebeck, 2023, geb., XII+369 S., € 89,–, ISBN 978-3-16-161674-7
„Wende deine Gedanken hin zum Lernen, um nicht an das Sündigen zu denken.“ Dieses Zitat Kyrills rahmt die Studie Religiöse Bildungsprozesse in den Taufkatechesen Kyrills von Jerusalem, die zugleich die überarbeitete Doktorarbeit der Autorin ist. Olga Lorgeoux möchte in dem Buch zeigen, dass und wie Kyrill die Taufvorbereitung in Jerusalem als einen Lehr-Lernprozess gestaltet und reflektiert. Dabei leitet sie ein breiter Bildungsbegriff, der insofern auch auf antike Texte übertragbar sei, als diese „ebenfalls den Menschen und sein Verhältnis zum Selbst, zur Welt und zu Gott bzw. Göttern reflektieren und […] vermitteln“ (5). Warum die Bezeichnung ‚religiöse‘ statt ‚christliche‘ Bildung gewählt wurde, bleibt für mich unklar; dies ist möglicherweise auch der Reihe geschuldet, in der der Band erschienen ist. Seit 2020 ist Lorgeoux als Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bildungsabteilung des Kirchenamtes der EKD tätig, ist also auch selbst in die religionspädagogische Arbeit eingebunden.
Ihrer Zielsetzung wird die Verfasserin in einer detailreichen, sorgfältig gearbeiteten Studie gerecht. Formal ist das Buch beinahe einwandfrei, eine Bibliographie und Register sind beigegeben. Durch Zwischenfazits und häufige Verweise auf ausführlichere Darstellungen ist die Untersuchung leserfreundlich. Lediglich im Haupttext sind solche Textbezüge mitunter störend, ebenso wie die zum Teil sehr bemüht wirkenden Übergänge.
Zunächst bietet Lorgeoux zwei einleitende Kapitel, die dem Leser notwendiges Hintergrundwissen vermitteln. Das erste Kapitel Historische und theologische Kontextualisierung (11–40) erläutert den formalen Rahmen der Jerusalemer Taufvorbereitung, die in der vorösterlichen Bußzeit als „alljährliche[r] Intensivkurs in christlicher Glaubenslehre“ (13) mit dem Jerusalemer Glaubensbekenntnis als Curriculum stattfand. Im zweiten Kapitel Kyrill von Jerusalem — Leben, Wirken und Schriften (41–68) wird der Bischof selbst in den Blick genommen als ein gebildeter Theologe, Lehrer und Prediger, der die katechetische Praxis in Jerusalem neu organisiert hat. Hier begründet die Autorin außerdem ihre Entscheidung, die Taufkatechesen auf das Jahr 351 zu datieren.
Neben den 18 Katechesen ist eine Prokatechese Kyrills überliefert, die im dritten Kapitel Die Prokatechese innerhalb des kyrillischen Bildungsprogramms (69–95) untersucht wird. Hier zeigt sich das Proprium der Studie, da die Autorin gegenüber der übrigen Forschungsliteratur in dem Text mehr als eine nebensächliche Einleitung sieht, indem sie besonders dessen pädagogischen Charakter herausarbeitet. Kyrill macht die Taufkandidaten in der Prokatechese mit dem von ihm angestrebten Bildungsprozess und -ziel vertraut und fordert sie zu aktiver Teilnahme daran auf. Theologisch sticht der militia-Christi-Gedanke heraus, den Kyrill besonders auf den antihäretischen Kampf bezieht. Religiöse Bildung wird als notwendige Vorbereitung für diesen geistlichen Kriegsdienst gedeutet, der gleichzeitig ekklesiologisch eingebettet ist. Hierin zeigt sich ein wesentlicher Ertrag des Buches: „Religiöse Bildung weist […] als wesentliche Grundlage christlichen Lebens über die Taufe hinaus“ (310; vgl. 145–147), ja sie ist letztlich eschatologisch motiviert. Das einleitende Zitat verweist auf die bleibende Bedeutung christlichen Lernens, insofern es die eigene Identität sichert und die fortwährende Ausrüstung im geistlichen Kampf ist.
Das längste, vierte Kapitel Die Auslegung des Jerusalemer Glaubensbekenntnisses (97–254) liest sich wie ein Kommentar zu Kyrills Katechesen. Die Autorin folgt hierbei dem Aufbau der Katechesen und behandelt demnach zunächst die Taufe selbst, einige anthropologische Grundannahmen sowie Kyrills Glaubensverständnis. Nach der fünften Katechese erfolgte in der Jerusalemer Taufvorbereitung die traditio symboli, die Übergabe des Glaubensbekenntnisses an die Taufkandidaten. Der Bischof legt ihnen das Bekenntnis als „Wegzehrung für die gesamte Zeit des Lebens“, „anvertrautes Gut“ und „Schatz des Lebens“ (145 — Kat V,12) ans Herz. Die aktive Auseinandersetzung mit den Glaubensinhalten, zu der bereits in der Prokatechese aufgefordert wurde, ist für Kyrill demnach keinesfalls mit der Taufe abgeschlossen.
Anschließend verhandelt der Bischof sowie Lorgeouxs Untersuchung die Topoi des trinitarisch aufgebauten Bekenntnisses. Dabei geht es der Autorin um die Frage, „wie Kyrill theologische Fragestellungen didaktisch aufbereitet und sprachlich vermittelt“ (255). Der Katechet erzählt beispielsweise biblische Geschichten von Sünde und Umkehr (David, Rahab) und will damit die Barmherzigkeit Gottes zeigen sowie die Zuhörer zu Buße auffordern. So verbinden sich theologische und pädagogische Ziele.
In diesem Abschnitt findet der Leser erkenntnisreiche Erläuterungen zur Theologie Kyrills, wie zum Beispiel die zentrale Stellung des Kreuzes in Soteriologie, Kirchenpolitik und Frömmigkeitspraxis. Daneben sind besonders die Ausführungen über Kyrills Verhältnis zu den theologischen Debatten seiner Zeit von Interesse. Während ein literarisches Eingreifen nicht überliefert ist, wird deutlich, dass er den Diskurs kennt und in dem Maße rezipiert, wie er es für seinen Kontext als ‚Religionspädagoge‘ für nötig hält. Er lässt die Streitigkeiten um das rechte Verständnis von Gott und der Beziehung zwischen Vater und Sohn nicht außen vor (wie wohl viele moderne Religionspädagogen versucht sind), macht aber auch keine akribischen terminologischen Festlegungen und kann gewisse Elementarisierungen vornehmen. Schärfe hält Kyrill dort für notwendig, wo es um die Erlösung geht. Dass seine spezifische Situation der Taufunterweisung für ihn leitend ist, wird auch an der Einbindung der Pneumatologie deutlich. Nicht erst bei Athanasius oder den Kappadokiern nimmt sie einen wichtigen Platz innerhalb der Gotteslehre ein, sondern bereits bei Kyrill, da „es von der Taufformel her unabdingbar war, die Kandidaten über den trinitarischen Glauben zu belehren, den sie dann durch eine rechtgläubige Gebets- und Frömmigkeitspraxis ausüben konnten.“ (189)
Das fünfte Kapitel Der Prozess religiöser Bildung in der Taufunterweisung (255–308) bildet den ‚religionspädagogisch‘ dichtesten Teil der Studie. Hier untersucht Lorgeoux Kyrills Reflexion der katechetischen Unterweisung und sein Selbstverständnis als Lehrer mit geistlicher und amtlicher Autorität. Zu den Charakteristika der katechetischen Praxis Kyrills gehören Polemik und Schriftauslegung, die auch auf Vermittlung von hermeneutischer Kompetenz zielt. Darüber hinaus wird Jerusalem als Lernort fruchtbar gemacht. Die Heiligen Stätten nutzt der Bischof pädagogisch als Zeugnis der Wahrhaftigkeit, als Ermahnung und als visuelle Glaubensunterstützung.
Zwei Erträge, die in dem Buch häufig wiederkehren, sind aus dem Schlusskapitel Religiöse Bildung in Jerusalem (309–322) hervorzuheben. Kyrill beschreibt religiöse Bildung als Trialog zwischen Lehrer, Zuhörer und Gott. Hierbei stehen auf der einen Seite menschliche Handlungsmöglichkeiten in der Pädagogik sowie in der persönlichen Aneignung und Reflexion. Glaube ist lehr- und lernbar und kann seinen Ausdruck in unterschiedlichen Lebensvollzügen innerhalb des Lernorts Kirche finden. Auf der anderen Seite bleibt der Glaube unverfügbar und ist an Gottes Gnadenwirken gebunden. Eine zweite Dynamik findet sich zwischen Orthodoxie und Orthopraxie. Kyrills Taufkatechesen zielen auf die „Vermittlung einer dogmatischen Bildung (im weitesten Sinne), die sich in einem ethisch verantworteten Handeln ausdrücken soll“ (259). Lorgeouxs Reflexion der Taufunterweisung in Jerusalem in der Mitte des 4. Jahrhunderts als religiösen Bildungsprozess bietet zahlreiche Gedankenanstöße: Inwiefern bezieht heutige religiöse — beziehungsweise christliche — Bildung Glauben und Handeln aufeinander? Wie verhalten sich verbindliche theologische Lehren zu unterschiedlichen Ausgestaltungen des christlichen Lebens? Welche Rollen werden den unterschiedlichen Akteuren in diesem Prozess zuerkannt?
Heindrikje Kuhs, Mühlacker