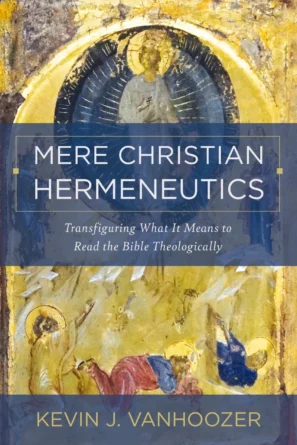Kevin J. Vanhoozer: Mere Christian Hermeneutics
Kevin J. Vanhoozer: Mere Christian Hermeneutics. Transfiguring What It Means to Read the Bible Theologically, Grand Rapids: Zondervan, 2024, geb., xxiv + 424 S., $ 39,99, ISBN 978-0310114512
Vanhoozer (Research Prof. an der Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Chicago) legt mit dem Buch „Einfache christliche Hermeneutik“ den dritten Band seiner „Mere“-Trilogie (Theology and the Mirror of Scripture. A Mere Evangelical Account (mit Daniel J. Treier, 2015) und Biblical Authority after Babel. Retrieving the Solas in the Spirit of Mere Protestant Christianity (2016)) vor. Dabei geht es ihm um das, was minimal alle Christen verbindet in der Frage nach der Theologie, der Bibelautorität und nun der Hermeneutik. Entstanden ist ein sehr konstruktiver Entwurf für eine reformatorisch-christozentrische Hermeneutik mit hoher ökumenischer Sensibilität.
Thematisch schließt sich mit diesem Werk ein Kreis, der mit V.’s preisgekrönter Auseinandersetzung mit postmoderner Hermeneutik in „Is there a meaning in this text?“ (1998; Jubiläumsausgabe 2009) begann. Allerdings setzt V. die Hauptaussage –Bibeltexte sind Teil des Kommunikationsprozesses des dreieinen Gottes – seines frühen Buches wohl voraus und führt nun Erkenntnisse (und seine Beiträge) zur „Theological Interpretation of Scripture“ (TIS) zusammen, einer Forschungsrichtung die im (US-)englischsprachigen Raum der letzten Jahrzehnte fruchtbar geführt wurde (xix). Sein Anliegen ist es, „die Bibel theologisch zu lesen“ (Untertitel): Die Bibel ist das Medium göttlicher Anrede (9). Beim Lesen der Bibel begegnet der Mensch dem lebendigen, dreieinen Gott, seiner Stimme. Dabei bleibt der Wortsinn der ursprünglichen historischen Situation (Literalsinn) wichtig und Grundlage auch für den geistlichen Sinn. Dass Gott in der Bibel auch „heute“ spricht, fügt der wörtlichen Bedeutung nicht etwas hinzu oder verfälscht es gar. Sondern der Heilige Geist lässt den Diskurs neu erklingen, reaktiviert ihn und situiert ihn neu in und für einen neuen heils-geschichtlichen Kontext (9-10). Wichtig ist dabei der kanonische Kontext und ein eschatologischer Referenzrahmen. So wird der (dafür offene) Leser/Hörer selbst verändert, ja umgestaltet (transfigured). Die Bibel zu lesen ist daher nicht nur informativ, sondern formativ (37). Echte reader-response auf die göttliche Anrede ist dialogisch und mündet in das Gebet „Hier bin ich“ (Gen 22,1).
Diese Sicht entfaltet V. nun ausführlich mit Argumenten und Begründungen mit Hilfe eines hermeneutischen Paradigmas, das bereits die Kirchenväter (Gregor v. Nyssa, Hieronymus) für das angemessene, geistliche Verstehen der Bibel verwendeten: Es geht wie bei dem Evangelienbericht der Verklärung (engl. transfiguration) von Jesus darum, „den hermeneutischen Berg zu erklimmen … um nach dem Licht Christi zu suchen“ (226). Das Lichtmotiv als Ort der Selbstoffenbarung Gottes findet sich von der Schöpfung bis zur Vollendung und für die Fragen der Hermeneutik besonders bedeutsam im Bericht der Gottesbegegnung des Mose (Ex 34) und dem Bericht der Verklärung Jesu. Dabei steht die „Verklärung“ (metamorphoo) der Person Jesus (Gesicht/Kleider werden weiß wie Licht/wie die Sonne) einerseits im Zentrum, was bedeutet: Jesus Christus ist der Skopus der Schrift (180ff). Transfigurale Auslegung ist darum eine Interpretation biblischer Texte, „bei der biblische Figuren in einer Weise ‘über’ (lat. trans) Zeiten und die Testamente [JB: AT/NT] hinweg verbunden sind, dass eine kohärente, einheitliche Erzählung mit Zentrum Jesus Christus entsteht“ (168). Gleichzeitig kann die von den Jüngern beobachtete Veränderung vom figuralen zum trans-figuralen an Jesus auf das Verhältnis von Literalsinn zur geistlich-theologischen Bedeutung eines Textes übertragen werden (analogia corporis, 228f): Transfiguraler Auslegung geht es „sowohl um den wörtlichen Sinn der Bibel als auch um das Licht im Buchstaben“ (xxii). Dieses „Licht im Buchstaben“ wird aber nicht unkontrollierbar mystisch oder phantasievoll allegorisch entdeckt, sondern wird ausgehend vom wörtlichen Sinne „wie die biblischen Worte entlang und über die Figuren hinaus zu den Realitäten hin laufen, welche diese Figuren andeuten und antizipieren“ (169) sichtbar. Und dies ist mit Hilfe aller zur Verfügung stehender methodischer Hilfsmittel, aber im Verstehensrahmen einer christlichen Weltsicht, des Kanons der Bibel und einer eschatologischen Ausrichtung erkennbar.
Vanhoozer formuliert im ersten Hauptteil (27-104) eine Auslegeordnung unter der Perspektive, ein „gutes“ Verstehen der Bibel brauche eine ihr angemessene Lese-Kultur. Dazu gehört eine entsprechende Interpretationsgemeinschaft (Kap. 1) mit passenden Werkzeugen (Kap. 2 sichtet kurz die Theologiegeschichte) und setzt die Überwindung der momentanen Polarisierung zwischen Biblischen Studien und Theologie voraus (Kap. 3). – Den zweiten Hauptteil (105-192) widmet er dem „Formalprizip der Hermeneutik“, dem „Buchstaben des Textes“, der historia, dem „was passiert ist“. Dieses Verstehen des Sensus Literalis geschieht in zwei Schritten: „Vom grammatischen Sinn hin zum eschatologischen Referenzrahmen“ in Kap. 4, in welchem die Philologie, Literalität und der Referenzrahmen für diesen wörtlichen Sinn thematisiert sind. Kap. 5 erarbeitet unter der Überschrift „Vom Figuralen zum Trans-figuralen“ und im Vergleich mit Typologie und Allegorie, was unter Figuration zu verstehen ist. Dabei wird vorgeschlagen, dass eine grammatikalisch-eschatologische Exegese mit dem trans-figuralen Literalsinn verbunden sein muss und eine christoscopische (s. oben) Sicht der Interpretation bereits zur Reformationszeit ein einseitiges rein historisches Verständnis verhindert hat. Die Bibel wörtlich lesen heißt für V. daher: „Die wörtliche Bedeutung der Schrift ist die buchstäbliche Bedeutung, verstanden als menschlich-göttlicher autoritativer Diskurs, wenn er in kanonischem Kontext mit einem eschatologischen Referenzrahmen gelesen wird.“ (179). Der geistliche Sinn ist so die eschatologische Fülle des wörtlichen Sinns, ja der theologische Sinn lässt den wörtlichen Sinn erst recht aufleuchten, „verherrlicht“ ihn. – Im dritten Hauptteil (193-356) geht es um das „geistliche Verstehen, welches mit der Geschichte korrespondiert“, die theoria, das Materialprinzip „einfacher christlicher Hermeneutik“. Dabei reiht sich das Lichtmotiv in den vier Kapiteln aufbauend aneinander. Kap. 6 („Licht auf Literalität werfen: Licht gebracht“) zeigt, dass bereits in der Schöpfung Gott sich durch Licht zu erkennen gibt und Gen 1,3 von mehr als dem physischen Licht spricht. „Die Verklärung Christi: Licht geoffenbart“ (Kap. 7) befasst sich ausführlich – auch exegetisch – mit den Evangelienberichten und schließt mit fünf Thesen zur „Verklärung als interpretativer Rahmen“. Kap. 8 beschäftigt sich unter dem Titel „Das Literale Transfigurieren: Licht gebrochen“ mit dem Verhältnis der beiden Testamente. Zentral ist die Frage, ob der Vorgang der transfiguralen Auslegung einseitig die biblischen Texte „vorwärts“ (vom AT zum NT) oder im Gegenteil „rückwärts“ (Christus zurück ins AT) liest. Mit „Den Leser umgestalten (transfigurieren): Licht reflektiert“ schließt Kap. 9 mit Ausführungen über die Auswirkungen des Bibellesens und -verstehens auf den mit dem Text (und damit Gott) ringenden Leser (mit ausführlicher Auseinandersetzung mit 2Kor 3 (und Ex 34)). – Ein zusammenfassendes Schlusskapitel, eine ausführliche Bibliografie, ein Glossar sowie ein Schrift-, Personen- und Sachindex runden das Buch ab.
Das Grundanliegen des Buches (biblische Exegese und lebensverändernde Theologie zusammenzuhalten) und der dazu vorgeschlagene Weg zu einer allgemeinen christlichen Hermeneutik überzeugen. Spannend und anregend sind die unterschiedlichen Bausteine und „Quellen“, die V.’s Entwurf nähren und bilden. Insgesamt rekurriert V. stark auf Kirchenväter (bis ins Mittelalter) und setzt sich z.B. kritisch-positiv mit den Fragen rund um deren allegorische Auslegung auseinander. Von den späteren „Vätern“ werden neben den Reformatoren vor allem Jonathan Edwards und Kierkegaard zu Gesprächspartnern, da beide sich ausführlicher mit der „Ökonomie des Lichts“ auseinandergesetzt haben. Gleichzeitig rezipiert (z. B. ausdrücklich Webster, The Culture of Theology) und diskutiert er eine grosse Anzahl moderner (englischsprachiger) Theologen und ihre jeweiligen Ansichten und Forschungsbeiträge, sowohl im Bereich der Bibelwissenschaften (AT und NT), als auch der Systematischen Theologie. Zudem findet sich in den Fussnoten eine Fülle englischsprachiger Literatur zur Hermeneutik, die im deutschsprachigen Raum kaum Beachtung findet (siehe 37 S. Bibliografie im Kleinstdruck). Zu Recht hat ein anderer Rezensent von Einschränkungen des Buches gesprochen: Wer hermeneutische Ausführungen und konkrete methodische Schritte zu den hauptsächlichen Verstehenshürden „Sprache“, „geschichtlicher Abstand“ und „Gültigkeit/Normativität heute“ sucht, wird sie hier nicht finden. Man ist sich unsicher, wie dieser Ansatz für manche inner-kirchliche (evangelikale) Auseinandersetzungen über Bibeltexte hilfreich sein könnte. Wer aber eine Wegleitung für ein ganzheitliches Lesen und Verstehen der Bibel sucht, der findet hier ein überaus konstruktives, gelehrtes und ausgereiftes Werk.
Dr. Jürg Buchegger-Müller, Pfarrer der Freien Evangelischen Gemeinde Wetzikon (Schweiz)