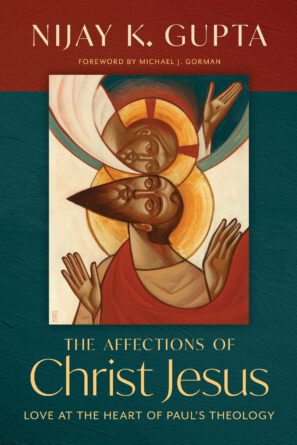Nijay Gupta: The Affections of Christ Jesus
Nijay Gupta: The Affections of Christ Jesus. Love at the Heart of Paul’s Theology, Grand Rapids: Eerdmans, 2025, Pb., xvii + 241 S., $ 34,99, ISBN 978-0802877161
Das Zentrum der paulinischen Theologie ist das Motiv der „Liebe“. So unüberschaubar die Paulusforschung mit ihren ständig neuen Ansätzen geworden ist, so überraschend erscheint es fast schon, dass Nijay Gupta (Neutestamentler am Northern Seminary in Illinois und Mitherausgeber von zwei neueren englischsprachigen Paulus-Sammelbänden) erst jetzt eine derart simple These als Forschungslücke erkennt und sie mit dem vorliegenden Werk zu begründen versucht (11).
Schon im Vorwort wird deutlich, dass die Studie nicht im allumfassenden Sinne zu verstehen ist, sondern bestenfalls als eine Annäherung an das Thema: Gupta macht explizit deutlich, keine langatmigen methodologischen Vorüberlegungen aufstellen (dazu verweist er auf sein früheres Werk, „Paul and the Language of Faith“, das sich mit der Zentralität des Motivs des Glaubens bei Paulus befasst) oder die Auswahl seiner Grundannahmen – unter anderem die paulinische Verfasserschaft des Epheserbriefes, die Verwurzelung von Paulus im Alten Testament sowie die Frage nach dem Verhältnis von Paulus zur Jesus-Tradition – verteidigen zu wollen (ix–xii).
In der Einführung wird das Defizit deutlich gemacht: So würden schon in der Untersuchung des Liebes-Motivs bei Augustinus die paulinischen Einflüsse vernachlässigt (3), ebenso die Tatsache, dass Wörter aus der (hier noch nicht näher definierten) „love language“ über 100 Mal und in jedem Brief des Corpus Paulinum vorkommen (4). Als Beispiele für Vernachlässigungen des Themas Liebe in der Paulus-Forschung werden Standardwerke von Dunn und Wright aufgeführt (8).
Bevor der Autor das eigentliche Thema der Studie behandelt, folgt in den ersten vier Kapiteln eine interdisziplinäre Begriffsdefinition. Diese umfasst eine Betrachtung des Konzepts „Liebe“ aus philosophisch-psychologischer Perspektive (unter anderem werden C.S. Lewis, die feministische Aktivistin bell hooks und die „appraisal theory of emotions“ ins Gespräch gebracht, 13–31), eine knappe Betrachtung der relevanten neutestamentlichen Wörter (32–36), eine Betrachtung des Konzepts im Alten Testament und der jüdischen Tradition (37–55), eine etwas ausführlichere Analyse der griechischen Begriffe (56–73) sowie einen Abriss des Motivs in der Jesus-Tradition (74–95).
Die eigentliche Untersuchung – nach einem Überblick über das Motiv der Liebe bei Paulus (96–111) – besteht aus einer Verortung des Motivs in den paulinischen Themenfeldern Evangelium (112–128, mit Fokus auf Röm 5-8), Religion (129–148, mit Fokus auf der Schema-Tradition) und Gemeinschaft (149–164) bzw. Liebe zu Außenstehenden (165–182). Etwas idiosynkratisch wirkt das letzte Kapitel, das sich der These widmet, die Liebe sei das Hauptthema des Epheserbriefes (183–205). Die Konklusion besteht aus sechs thesenhaften Formulierungen (206–215), etwa, dass die paulinische Fokussierung auf Gottes Liebe in den jüdischen Heiligen Schriften und Tradition verwurzelt ist (211–212). Ein Anhang mit frühchristlichen Bezügen zu Liebe zu Gott bzw. Liebe zum Nächsten rundet die Arbeit ab (217–218).
Insgesamt gelingt es Gupta, seine simpel klingende These auf eine entsprechend unkomplizierte Art zu erläutern, wobei die Darstellung sich gut als Einstieg für Paulus-Laien eignet. Es findet eine Diskussion mit aktueller Literatur und Forschungstrends statt (wenn auch mit Schwerpunkt auf englischsprachige Quellen); kontroverse Debatten werden dabei gemieden. Wie schon in der Einführung deutlich wird, erhebt die Studie nicht den Anspruch, einen radikal neuen Ansatz zu präsentieren. Entsprechend unkontrovers fallen die Schlussfolgerungen aus. Vor allem der interdisziplinäre Zugang, der die Untersuchung von einem starr begriffsgebundenen Ansatz abgrenzt, wirft einen neuen Blick auf die Thematik (z. B. die emotionale Komponente der Liebe, 24–30) und schafft Potenzial für Verknüpfungen zwischen der paulinischen Theologie und praktisch-theologischen Fragestellungen.
Die Stärken des Buches sind zugleich seine Schwächen. Zwar klingt die These der Zentralität von Liebe bei Paulus plausibel, jedoch wirft ihre Begründung viele Fragen auf. Die fehlenden methodologischen Überlegungen ausgenommen, fällt ein hoher Grad an Eklektizismus auf: Während sich der AT-Teil stark auf das Schema fokussiert, wird etwa dem Hohelied wenig Beachtung geschenkt; ähnlich verhält es sich mit der Gewichtung von Röm 5-8 gegenüber etwa Gal 2,20 im sechsten Kapitel. Phil 1,8 – immerhin die Inspiration hinter dem Buchtitel! – wird neben einer kurzen Erwähnung nur knapp im Schlussteil der Arbeit thematisiert (210-211). Lediglich etwa die Hälfte der Studie widmet sich den eigentlichen Paulusbriefen, wobei selbst hier noch die methodologisch unpassende Darstellung von Paulus in der Apostelgeschichte (171–176) sowie im letzten Kapitel der Epheserbrief dazuzählen.
Gerade die Untersuchung des Epheserbriefs als Krönung der Studie – an sich eine gewagte wie willkommene Abwechslung (und bezeichnend für den englischsprachigen Raum, in dem es noch vergleichsweise viele Vertreter der paulinischen Verfasserschaft gibt) – ist eher enttäuschend, weil es sich um eine relativ unsystematische Betrachtung handelt, bei der kaum eine Auseinandersetzung mit Experten des Epheserbriefes stattfindet. Dies gilt im Übrigen, wie oben bereits erwähnt, bis zu einem gewissen Grad für die gesamte Arbeit. Insbesondere deutschsprachige Paulus-Standardwerke, wie etwa von Horn, Schnelle oder Becker / Wischmeyer, werden nicht beachtet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es der Studie gelingt, für ein in der Paulusforschung eher vernachlässigtes Thema zu sensibilisieren – und das im Dialog mit dem (zumindest in bestimmten Teilen der Erde) aktuellen Forschungsstand und auf eine zugängliche Weise. Mit Gupta zu schlussfolgern, dass „anything that can be said about Paul’s theology is really about love” (207), fällt am Ende der Arbeit dennoch schwer – zu selektiv, unausgewogen und oberflächlich fällt dafür die exegetische Analyse im Hauptteil aus. Da ist die These, „Liebe“ sei das Zentrum der paulinischen Theologie, wohl doch komplexer und bedarf gründlicherer Untersuchungen, beispielsweise von einzelnen Briefen des Corpus Paulinum nach dem Motiv der Liebe. Bleibt zu hoffen, dass „The Affections of Christ Jesus“ dazu anregt.
Alexander Dalinger, Doktorand an der TU Utrecht / FTH Gießen, Gastdozent an theologischen Ausbildungsstätten in Deutschland und der ehemaligen UdSSR über die Kontaktmission