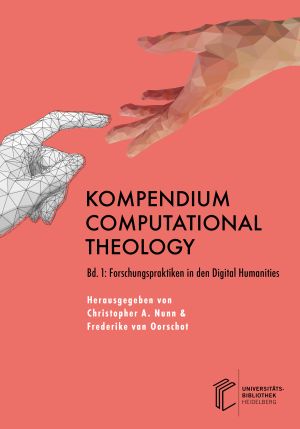Christopher A. Nunn, Frederike van Oorschot (Hrsg.): Kompendium Computational Theology
Christopher A. Nunn, Frederike van Oorschot (Hrsg.): Kompendium Computational Theology, Bd. 1 Forschungspraktiken in den Digital Humanities, Heidelberg: heiBOOKS, 2025, Softcover, 524 S., € 52,–, ISBN 978-3-911056-18-2. Kostenlos als eBook: https://doi.org/10.11588/heibooks.1459
Dr. Christopher A. Nunn (Qualitätsmanagementbeauftragter und Programmkoordinator für den Masterstudiengang Theological Studies an der Universität Heidelberg) und Privatdozentin Dr. Frederika von Oorschot (Leiterin des Arbeitsbereichs „Religion, Recht und Kultur“ an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V., FEST, Heidelberg) legen mit diesem Sammelband Ergebnisse und Beiträge vor, die im Umfeld des TheoLab an der Universität Heidelberg zu verorten sind. Diese Forschungsaktivitäten liegen zwischen der Theologie und den Digital Humanities (DH) und werden von den Herausgebern als „Computational Theology“ bezeichnet. Dieser Begriff ist nach eigenen Angaben von den Herausgebern maßgeblich geprägt und entwickelt worden (9). Das Anliegen des ersten Bandes ist eine breite Einführung in verschiedene Forschungsrichtungen und soll nicht nur für Theologen von Interesse sein.
Ihr weiteres Vorgehen und die Hintergründe legen die Herausgeber in ihrem ersten Beitrag „Kompendium Computational Theology – eine Hinführung“ dar. Sie führen dazu breit in das Feld der Digital Humanities ein und stellen die dortigen wissenschaftlichen Spannungsfelder angemessen dar. Sie bemerken, dass die Theologie als Fach dort kaum vertreten ist. Hier würden „entweder große Vorbehalte dagegen bestehen, sich überhaupt auf die DH einzulassen, oder zumindest Unsicherheiten bzgl. sinnvoller Forschungsfragen und Möglichkeiten der technischen Umsetzung existieren“ (17). Als Begründung führen sie fehlende Infrastruktur und neben wissenschaftlichen Vorbehalten auch das Fehlen von Grundlagenwerken an. Letzteres kann sich allerdings nur auf die deutschsprachige Welt beziehen, man vergleiche die Arbeiten von Sutinen und Cooper, Philipps, oder Kurlberg um nur einige zu nennen.
Da andere Fachbereiche hier schon eine eigene wissenschaftliche Struktur (z. B. in Form von Digital History) ausgebildet haben, fordern die Herausgeber ein ähnliches Vorgehen für die Theologie. Allerdings sehen Sie hier keine direkte Anschlussfähigkeit an die Digital Humanities, da die Theologie auch noch weitere Bereiche wie Digitale Ethik oder die Digitalisierung der Theologie umfassen würden. Mit dieser Feststellung liegen sie richtig, auch wenn sie nicht alle relevanten Bereiche nennen. Damit stellen sich die Autoren gegen den international bereits etablierten Begriff „Digital Theology“ und grenzen sich mit ihrer „Computational Theology“ davon ab. Die vielfältigen weiteren Überschneidungen zu anderen Gebieten, wie der Philosophie des Digitalen und den Computational Social Sciences werden nicht beachtet. Insofern bleibt die neue Begriffseinführung letztlich unklar und erschwert den Zugang für Außenstehenden.
Die Herausgeber konnten in mehreren thematischen Abschnitten verschiedene Beiträge mit ganz unterschiedlicher Qualität zusammenstellen. Entgegen dem Untertitel werden allerdings nicht alle Forschungspraktiken der Digital Humanities vorgestellt, es liegt der Fokus auf der Arbeit mit textuellen Daten. Aufgrund der Engführung des Begriffs „Computational Theology“ erklärt sich allerdings immerhin die Einschränkung auf die Digital Humanities, und so finden nicht aller Teilbereiche der Theologie ihr Gegenstück.
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem „Vorhaben und [der] Begriffsbestimmung“. Hier ist zum Beispiel der beachtenswerte Beitrag von Michael Piotrowski zum Spannungsfeld zwischen DH und der Theologie zu nennen. Der Beitrag über Videospiele von Erin Raffety versucht sich an einer Perspektivbestimmung im Rahmen der Human Computer Interaction. Nunns ebenfalls lesenswerter Beitrag führt in seine Definition von Computational Theology ein, wobei die oben schon angesprochenen Aspekte eigentlich mitdiskutiert werden müssten.
Der zweite Abschnitt fasst Beiträge zum Thema „Multimediale Zugänge der Digital Humanities“ zusammen, etwa zur Text- und Bilddigitalisieren, Audio- und Musikanalysen sowie Film- und Videoanalysen. Diese soliden Beiträge entstammen der Feder von Experten aus dem Feld Digital Humanities, was man an der Qualität auch deutlich merkt.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit den Formen digitaler Textanalyse. Der Einstiegsbeitrag von William Mattingly „Python oder R? Einstieg zum Programmieren in den Geisteswissenschaften“ sticht zunächst hervor. Mit seiner Stoßrichtung – der Analyse großer Textkorpora – passt er thematisch, allerdings weckt der Titel falsche Erwartungen. Der Beitrag ist kein Einstieg in die Programmierung, sondern bleibt seltsam vage: „Programmieren soll die traditionelle humanistische Forschung nicht ersetzen, sondern eröffnet den Geisteswissenschaftler*innen neue Wege der Forschung. Es ermöglicht uns, Fragen zu stellen, die wir sonst nicht beantworten könnten.“ (209) Es werden im Buch durchweg lediglich Praktiken und Methoden der Forschung beschrieben. Das benennt der Untertitel des Bandes auch richtig. Als Spannungsfeld im gesamten Sammelband ergibt sich aber, dass kein wirklicher, konkret greifbarer Ausblick in die wissenschaftliche Praxis oder überhaupt in die Praxis gemacht wird. Die weiteren Beiträge sind von gemischter Qualität. Herausstechend sind etwa die Beiträge von Fotis Jannidis oder Alexander Lasch. Anderen Beiträgen, etwa von Caitlin Burge zur Netzwerkanalyse, hätte bei der Zusammenstellung auch eine Überarbeitung gutgetan. Burge beispielsweise schafft es nicht nur, über hundert Jahre Netzwerkforschung mit dem lapidaren Hinweis auf ein paar „Jahrzehnte“, in denen sie an „Popularität gewonnen“ hätte, abzuarbeiten, sondern lässt auch die Verbindung zur Theologie, abgesehen von der Nennung einiger Autoren, völlig vermissen. Die von ihr angekündigten „Best-Practice-Beispiele“ sind eine einfache Auflistung von Forschungsarbeiten.
Der vierte Abschnitt „Dissemination“ beschäftigt sich schlussendlich mit Wissenschaftskommunikation, virtuellen Forschungsumgebungen, Forschungsdatenmanagement und auch der KI-gestützten Textproduktion an Hochschulen. Die lesenswerten Beiträge bieten aber erneut vor allem eine Perspektive der Digital Humanities. Dies ist vielleicht die größte Stärke des Buches: Sie bietet eine Auswahl von Themen der Digital Humanities zur Arbeit mit Texten und führt diese – überwiegend auf hohem Niveau – ein. Gleichzeitig ist die Auswahl entgegen der ja Eingangs schon diskutierten methodischen Bandbreite der Theologie, über die DH hinausgehend, hier nicht abgebildet.
Auch weitere Beiträge zu aktuellen Themen, beispielsweise zur Künstlichen Intelligenz, fehlen. Hierzu wären aber vermutlich methodische Einführungen und nicht nur die Beschreibung von Forschungspraktiken nötig gewesen. Davor scheut der Sammelband aber zurück. Eine mögliche Erklärung liefert der Beitrag von Clifford Anderson, der eine Vermittlung informatischer oder gar mathematischer Inhalte ablehnt und stattdessen für den Aufbau von Teams oder Laboren plädiert. Die Existenz der gar nicht so wenigen interdisziplinären Studiengängen, Bindestrich-Informatiken, Digital Humanities oder sogar die Verwendung statistischer Verfahren, z. B. in den Sozialwissenschaften, scheint eine davon völlig entkoppelte Entwicklung zu sein. Neben der thematischen Engführung und der Entkopplung von Praxisbezügen ist letztlich die fehlende Beschäftigung mit informatischen und mathematischen Grundlagen ein weiteres Problemfeld des Sammelbandes. Nimmt man diese Aspekte zusammen, verwundert das derzeit angekündigte Inhaltsverzeichnis des zweiten Bandes aber dann doch: Neben Themen der klassischen Digital Humanities, insbesondere der Arbeit mit dem Text (Kirchengeschichte, Exegese, Homiletik) erscheinen nun auch soziologische und pädagogische Themen. Hier hätte man sich von den Herausgebern entweder eine verständlichere Begründung oder eine gelungenere Auswahl der Themen gewünscht.
Somit bleibt die Frage nach der Zielgruppe dieses Buches. Für Studierende und Forschende im Bereich der Digital Humanities und anderen Geisteswissenschaften gibt es bereits einige gute Einführungen. Hier mag sich dieser Band gut einreihen, auch wenn die Passgenauigkeit der einzelnen Beiträge für die Arbeit mit Studierenden vorher individuell geprüft werden muss. Für Studierende und Forschende der Theologie fehlt die nötige thematische Bandbreite über den Schwerpunkt Textanalyse hinaus ebenso wie grundlegende methodische Inhalte. Es ist zu hoffen, dass der zweite Band auch die praktischen sowie praktisch-methodische Perspektiven näher beleuchtet. Zur Begriffsbestimmung der Theologie und der digitalen Methoden gibt es bereits vielfältige internationale Beiträge, die durchweg weniger einseitig ausfallen. Insofern dokumentiert dieser – trotz aller Kritik lesenswerte – Band vor allem eine deutschsprachige Perspektive.
Das Werk ist in deutscher Sprache verfasst, sprachlich zugänglich, auch wenn es sich definitiv an Fachkundige und nur am Rande an interessierte Laien richtet. Eine englischsprachige Version ist auch vorhanden, wobei sich diese Rezension auf die deutsche Ausgabe bezieht. Eine Bibliographie findet sich in jedem Beitrag und ein Glossar rundet das Werk ab. Der Textsatz des Buches ist gut lesbar, wobei viele Beiträge von weiteren Abbildungen und Illustrationen profitieren könnten. Das Werk ist als Open Access Publikation kostenfrei und ohne Zugangsbeschränkungen lesbar.
PD Dr. Jens Dörpinghaus, Research Associate, University of Pretoria, Faculty of Theology and Religion, Hatfield, Pretoria, South Africa. Privatdozent an der Universität Koblenz, Fachbereich 4, Informatik.