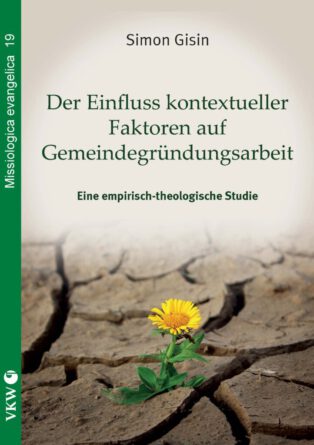Simon Gisin: Der Einfluss kontextueller Faktoren auf Gemeindegründungsarbeit
Simon Gisin: Der Einfluss kontextueller Faktoren auf Gemeindegründungsarbeit. Eine empirisch-theologische Studie, Missiologica Evangelica 19, Bonn: Verlag für Kultur und Wissenschaft, 2024, Pb., 419 S., € 34,–, ISBN 978-3-86269-299-6
Die häufig gebrauchten Metaphern von „Offenen Türen“ oder „hartem Boden“ einer Region stützen sich in der Praxis von Gemeindegründern, Pastoren, Pfarrern und Gemeindemitarbeitern auf Erfahrungswissen.
Der Schweizer Theologe Simon Gisin stellt in seiner Studie, die an der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel 2022 als Dissertation angenommen wurde, die Frage, ob diese populären Deutungen empirisch und theologisch haltbar sind. Seine primäre Forschungsfrage untersucht, welche äußeren kontextuellen Faktoren die Entwicklung von Gemeindegründungen beeinflussen – mit dem Ziel, realistischere Einschätzungen für neue Projekte zu ermöglichen und so Menschen mit dem Evangelium zu erreichen.
Im einleitenden Kapitel (15–19) begründet Gisin die empirisch-theologische Methodik seiner Studie, die sich im Forschungsfeld auf freikirchliche Gemeindegründungen in der deutschsprachigen Schweiz fokussiert.
Vor dem Hintergrund der Forschungsfrage werden die in Kapitel 2 (21–48) zu klärenden Grundbegriffe abgeleitet. Dabei werden die Kennzeichen der Kirche aus reformatorischer Perspektive definiert. Ein zentraler Gesichtspunkt ist dabei der Prozess der Gemeindegründung, der anhand einer Auswahl von Gründungsliteratur erarbeitet und in vier Phasen mit ihren Übergängen unterteilt wurde: Vorbereitung, Sichtbarwerdung, Wachstum und Multiplikation. Zwischen diesen vier Messpunkten werden mittels Konversionserfahrungen von Menschen aus dem Gründungskontext weitere Phasen skaliert. Der Grad der Erreichung wird durch deskriptive Statistik ausgewertet und visualisiert.
Dabei spielt die Phase der Selbstständigkeit der neuen Gemeinden eine wichtige Rolle. Der relevante Zeitpunkt wird gemessen, wenn es zu Begegnungen mit Menschen aus dem Gründungskontext kommt, um ihnen das Evangelium mitzuteilen. Deshalb ist die Konversion in der Studie von zentraler theologischer Bedeutung – als „initialer Akt“ und als beständige Hingabe zu Gott. Gisin warnt vor dem Trugschluss, dass erfolgreiche Gemeindegründung rein quantitativ an schneller Selbstständigkeit und vielen Konversionen messbar sei, während Gemeinden, die diese Erfahrungen nicht erleben, als gescheitert gelten. Gisin argumentiert theologisch für die „Grenze der Messbarkeit“, da das, was empirisch als gescheitert oder gelungen gemessen wird, mit dem Rückverweis auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus zu bewerten ist. Die Kreuzestheologie zeigt, dass das vermeintliche Scheitern (am Kreuz) aus der göttlichen Perspektive der Auferstehung heraus ein Sieg ist. In diesem Rahmen entfaltet Gisin auch den „ontologischen Bezug des Bleibens in Jesus“ (47). Wird die Studie damit obsolet? Keineswegs – Gisin macht vielmehr deutlich, dass sich ein abschließendes menschlich-empirisches Bewerten im kirchlich-geistlichen Kontext dem Menschen entzieht. Die Studie will also nicht über Erfolg und Misserfolg urteilen, sondern kirchensoziologische und theologische Impulse zur Wahrnehmung möglicher Einflussfaktoren geben.
Kapitel 3 (49–94) bildet das deduktive Forschungsdesign ab. Die Hypothesenbildung basiert auf der Analyse der Gemeindegründungsliteratur, die aus elf Büchern und drei Studien besteht, mehrheitlich aus dem freikirchlichen US-amerikanischen Raum, rezipiert im europäischen Kontext sowie in der deutschsprachigen Gründungsliteratur. Auch landeskirchliche Literatur wird berücksichtigt, um ein umfassenderes Bild zu zeichnen. Die zentrale Frage lautet: Wie reflektiert die Gründungsliteratur den Kontext und welche Faktoren gelten als förderlich oder hinderlich? Die Bildung von 23 Hypothesen erfolgt nicht nur literaturgestützt, sondern auch durch eine differenzierte Analyse vorhandener Sekundärdaten (politisch, religiös, sozial, wirtschaftlich u. a.) mittels der Methode der Exploration. Diese Vorgehensweise lässt konkrete Erwartungen an die empirischen Ergebnisse entstehen.
Kapitel 4 (95–276) beinhaltet den empirischen Hauptteil der Studie. Gisin reflektiert zunächst hermeneutisch sein Verständnis des Verhältnisses von Theologie und Empirie und bezieht sich auf den klassischen praktisch-theologischen Dreischritt „sehen – urteilen – handeln”. Obwohl Gisin das Aufeinanderbezogensein von Empirie und Theologie betont, behält für ihn die Theologie das Primat und dient als maßgebliches „Beurteilungskriterium” für die Deutung der empirischen Daten.
Die anspruchsvolle empirische Untersuchung basiert auf einer Vollerhebung freikirchlicher Gemeindegründungen in der deutschsprachigen Schweiz zwischen 1990 und 2018. Insgesamt werden 117 Gemeindegründungsprojekte (119) analysiert. Angesichts der Komplexität der Datenlage wählt Gisin ein Triangulationsdesign, das quantitative und qualitative Methoden kombiniert. Die Entscheidung, zudem das Vertiefungsmodell zu wählen, ist plausibel, da sich die postulierten Hypothesen besonders adäquat durch quantitative Methoden überprüfen lassen. Dies gilt insbesondere für die Analyse von Effektstärken in den Zusammenhängen zwischen äußeren Kontextfaktoren und den Gemeindegründungsprojekten, bei denen statistische Signifikanzen ermittelt werden können. Solche starken Effekte statistischer Wahrscheinlichkeit konnten im Rahmen der Untersuchung tatsächlich nachgewiesen werden. Dabei ergab sich folgendes Bild (261–265):
A) Einflussfaktoren auf eine Gemeindegründung (Hypothesen bestätigt):
- Neubaugebiete – sie fördern Gemeindegründung, was auf neuzugezogene und aufgeschlossene Menschen hinweist.
- Politische Einstellungen (Parteistärken) eines Ortes.
- Hoher Anteil junger Familien an Vierpersonenhaushalten.
- Wirtschaftlich schwächere Regionen mit erhöhter Arbeitslosigkeit.
B) Faktoren ohne Einfluss auf Gemeindegründungen (Hypothesen widerlegt):
- Orte mit hoher Mobilität.
- Touristisch stark frequentierte Orte.
- „Es ist einfacher, unter jungen Menschen eine Gemeinde zu gründen.“
- Orte mit hohem Anteil von Menschen über 65 Jahren.
Auf die quantitativen Methoden folgen – auf Grundlage des Vertiefungsmodells – die mündlichen Befragungen von sieben Personen sowie die Analyse der Rolle des Gemeindegründers, wie sie aus der Gründungsliteratur (Kap. 2, 194–260) abgeleitet wurde. Die eingangs erwähnte Redewendung der „Offenen Türen“ ist ebenfalls Teil der qualitativen Auswertung, wird jedoch im anschließenden Kapitel (5.3) behandelt.
In Kapitel 5 (277–389) werden die interdisziplinären Ergebnisse in einer Synopse ausführlich theologisch diskutiert. Im ersten Teil (5.1) betrachtet Gisin die Ergebnisse im Licht ekklesiologischer und missiologischer Perspektiven. Die vier Grundvollzüge kirchlichen Handelns – Martyria, Leiturgia, Koinonia, Diakonia – dienen als Raster zur Auswertung der Gründungsinitiativen. Der in der neueren Literatur diskutierte fünfte Grundvollzug der Kirche – „Paideia“ im Sinne von „Bildung, reflexivem Handeln“ und „Persönlichkeitsentwicklung“ – bleibt in der Auswertung unberücksichtigt.
Der zweite Teil (5.2) enthält anregende Rückfragen zur „Notwendigkeit neuer Gemeinden“, auch im Verhältnis zu bestehenden Landeskirchen, und formuliert daraus Zielsetzungen. Teil 5.3 beleuchtet die Wendung von den „Offenen Türen” a) anhand der Interviews, b) der Gründungsliteratur und c) einer biblisch-deskriptiven Begriffserklärung. Darauf aufbauend folgen konkrete praktisch-theologische Applikationen.
Der vierte Teil (5.4) widerlegt mit realen praktisch-theologischen Beispielen sowie dem Gleichnis Jesu vom vierfachen Ackerfeld die prognostizierte Zuweisung vom „harten Boden“ als populäre Mythenbildung. Als gesichert gelten hingegen die stärksten Einflussfaktoren. Dazu zählen Familie und Arbeitslosigkeit, die theologisch beachtenswerte Reflexionen enthalten (357–389). Gisin folgert: Das unbegründete Etikett vom „harten Boden“ darf nicht im Vorfeld dazu führen, dass Gemeindegründungen in bestimmten Gebieten vermieden werden, denn „erst im Gründungsvollzug wird die Resonanz erfahren“ (389). Dem angstfreien Agieren ist zuzustimmen, der Widerlegung des „harten Bodens“ fehlt jedoch eine kritische Auseinandersetzung zwischen einem sozialwissenschaftlich säkularen sowie einem biblischen Weltbild – ein Desiderat, auf das der differenzierte Beitrag von Hannes Wiher in Evangelische Missiologie 2019/4, 165–186 nachdrücklich hinweist. Kapitel 6 fasst die Gesamtergebnisse komprimiert zusammen.
Das Buch endet mit Verzeichnissen: Abbildungen, Tabellen und ein Bibelstellenregister. Abkürzungsverzeichnis sowie Transkriptionsregeln stehen sinnvoll am Anfang (11–12). Interessierte Leser erhalten eine Lesehilfe (18–19).
Fazit: Gisins Studie ist ein bedeutender Beitrag zur Gemeindegründungsforschung und Empirischen Theologie im deutschsprachigen Raum. Das Buch bietet fundierte Einsichten für Gemeindegründer, Projektleiter und Mitarbeiter sowie empirisch forschende Studierende.
Prädikat: Empfehlenswert – die Studie wurde mit magna cum laude ausgezeichnet.
Dr. Manfred Baumert, Supervisor im Bereich der Praktischen Theologie an der University of South Africa, Pretoria