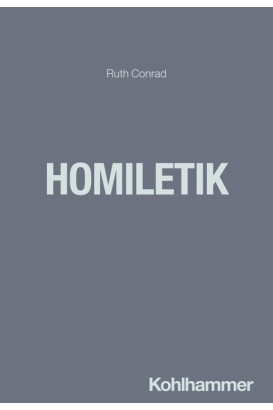Ruth Conrad: Homiletik
Ruth Conrad: Homiletik, Kompendien Praktische Theologie 7, Stuttgart: Kohlhammer, 2024, kt., 170 S., € 32,–, ISBN 978-3-17-034086-2
Homiletik wächst durch Erfahrung. Auf dieser Tatsache gründet auch die vorliegende Publikation, in der die Autorin ihrer jahrelangen homiletischen Vermittlungserfahrung auf 145 Seiten mit anschließendem Literaturverzeichnis und Index Raum schafft. Auf dem Hintergrund der bereits in den Anfängen der Praktischen Theologie geführten Diskussion um Theorie und Praxis leitet Dr. Ruth Conrad ihre Darlegung ein mit der Feststellung „Die Praxis geht der Theorie voraus“ und meint damit auch, dass das Evangelium der Kirche vorgeordnet ist. Deshalb ist die Kirche selbst nicht Gegenstand der eigenen Verkündigung. Denn: „Kirche gibt es aufgrund des Wortes Gottes“ – nicht umgekehrt (44). Sie stellt in ihrem Konzept die gelungene Reflexionsfolie von Individualität und Sozialität in den Vordergrund und nimmt mit diesen Dimensionen ein in der Praktischen Theologie wesentlich gewordenes Spannungsfeld auf. Dieses stellt sie in die Verbindung von Predigtziel und Kirchenbild. In ihrer Habilitationsschrift lassen sich hierzu vertiefende Kerngedanken und weitere Hintergründe gut nachvollziehen.
In diesem Band 7 der Reihe „Kompendien Praktische Theologie“ gibt die Verfasserin, Professorin für Praktische Theologie mit den Schwerpunkten Homiletik, Liturgik und Kirchentheorie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität in Berlin, Kernpunkte ihrer eigenen, gewachsenen Vermittlung wieder. Ihren aktuellen Forschungsfokus hat sie u. a. auf die „Kulturtheorie und Kulturgeschichte der christlichen Predigt im interkulturellen und interreligiösen Vergleich“ gelegt. Das spiegelt sich sowohl in der Bandbreite der integrierten Sichtweisen bezüglich konfessioneller Unterschiede, als auch kultureller Differenzierungen zwischen US-Kontext und deutschem Umfeld (insbesondere bzgl. Tertiärmedien, 92) wider. Ebenso zeigen es Hinweise auf islamische Predigten (39) im Sinne einer komparativen Homiletik.
Im Verlauf der dicht verfassten Darlegung werden besonders Verbindungen mit den drei Perspektiven 1) Homiletik und Kirchentheorie (Kirchenbild / Predigtziel), 2) Pluralität der Predigtkulturen und 3) wechselseitige Dynamik zwischen individueller Religion und deren gemeinschaftlicher Praxis (Individualität / Sozialität) hervorgehoben. Dabei verfolgt sie das Ziel, Predigt als soziale Praxis darzustellen und die Zielgruppe als konstituierende Größe zu definieren.
Während sich im ersten Teil Grundlagen zu Begriffen, Kontexten, Themen der Homiletik, dem aktuellen Diskurs und der Zusammenhang von Kirchenbild und Predigtideal finden, spiegelt der zweite Teil exemplarisch historische Konstellationen entlang theologiegeschichtlicher Linien wider. Dabei reichen die Darstellungen von der Reformation über Pietismus und Aufklärung, sowie Schleiermachers Grundlegungen der Praktischen Theologie bis hin zum Beitrag der Empirie und einer digitalen Kirche. Im abschließenden dritten Teil geschieht eine Systematisierung der bisherigen Inhalte in den Wechselverhältnissen, die sie als Bewältigungsaufgabe für Predigtpersonen ansieht: Liturgie und Emotion, Person und Tugend sowie Absicht und Inhalt (vertiefend dazu Conrads Werk „Weil wir etwas wollen! Plädoyer für eine Predigt mit Absicht und Inhalt“). Abschließend greift sie die einleitende Thematik von Kirchenbild und Predigtideal auf und endet mit einer offenen Frage. Eine nach ihrem Konzept verstandene Predigt bringt den originären Beitrag christlicher Religion für eine humane Welt zur Darstellung (143). Ob dies gelingt, bleibt eine offene Frage, aber die Autorin ist zuversichtlich.
Der spezielle homiletische Ansatz von Conrad zeigt eine Aktualisierung von Schleiermachers Theologie- und Religionsverständnis. Diese Perspektive ist angereichert mit guter wissenschaftlich-fundierter Literatur und Bandbreite. Enttäuscht sieht sich (wie die Autorin selbst betont) ein Leser, der Überblickswissen sowie Tipps und Hinweise für die Erstellung und Umsetzung der Predigt in der Praxis sucht. Ebenso wird ein dogmatischer Standpunkt vernachlässigt, da sich die Autorin von dogmatischen, ethischen und moralisierenden Ansätzen distanziert. Hier werden positionelle Differenzen deutlich.
Das Werk hat sich vor allem der prinzipiellen Homiletik verschrieben und bietet dennoch auch konkrete Anregungen für die Gottesdienst- und Predigt-Reflexion. Hier integriert die Autorin spezielle Hinweise zu digitaler Kirche und den Dimensionen von Medien (89ff) und das aufgegriffene kulturwissenschaftliche Konzept von Emotion als soziale Praxis (113f, „Welche Emotionen möchte ich auslösen?“). Ebenso stellt sie heraus, welcher Anteil an öffentlicher Partizipation in der religiösen Kommunikation Frauen zukommt, und würdigt dabei besonders die Möglichkeiten zu Beginn des Pietismus. Dies regt zum Weiterdenken an und dient als Anreiz zur weiteren Forschung und der Würdigung der von damals ausgehenden prägenden Wirkung.
Im Wechselspiel, wie sie es nennt, zwischen Kirchenbild und Predigtziel (10) hat sie – nach Eigenaussage – eher einen homiletischen Essay als ein Kompendium verfasst. Die Fülle und Breite an integrierten homiletischen Modellen mag dem widersprechen. Dem Stil und Spiel mit anregenden Gedanken nach ist dem zuzustimmen. Der Ansatz einer liberalen prinzipiellen Homiletik mit der Zielsetzung humanitärer Religion (im Sinne Schleiermachers) würdigt stark den Einzelnen und den jeweiligen Fokus. Das Plädoyer für Menschenfreundlichkeit (142) und eine reflexive Haltung, die auch Gefährdungen aufgreift, die Fluchttendenzen in Appell und Moral betreffen, sind positiv hervorzuheben und regen zum Überdenken eigener Predigttätigkeit an. Denn die Lebensfragen der Menschen in den Blick zu nehmen, verändert die Tonlage, wie sie betont. Sicherlich wäre aber nicht nur die Tonlage, sondern auch die Melodie und vor allem die Quelle des vermittelten Inhalts dabei nicht unerheblich.
Und so scheint es, dass bei diesem Ansatz zwar ein Außen mit sozialer Wirkung angestrebt wird, diese Ausrichtung letztlich jedoch den Einzelnen mit seiner eigenen religiösen Kraft allein lässt und nicht mit einer anderen Welt rechnet, außer der sozialen. Insgesamt erscheint der Band als eine hilfreiche Darlegung zur Unterscheidung von darstellendem und wirksamem Handeln in der Predigt.
Joachim Klein, Fachbereichsleiter Praktische Theologie am Theologischen Seminar Adelshofen.