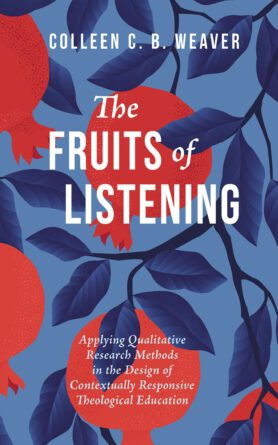Colleen C. B. Weaver: The Fruits of Listening
Colleen C. B. Weaver: The Fruits of Listening. Applying Qualitative Research Methods in the Design of Contextually Responsive Theological Education, Eugene: Wipf & Stock, 2024, kt., 214 S., € 27,–, ISBN 979-8-3852-2280-3
Wo steht die theologische Ausbildung in Europa und wie gestaltet sich ihre Zukunft? Was sind besondere Herausforderungen und wo kann man voneinander lernen?
Colleen Weaver arbeitet u. a. als Dozentin am Baltic Methodist Theological Seminary in Estland und war zuvor viele Jahre als Missionarin in Spanien tätig. Mit The Fruits of Listening legt sie ihre überarbeitete Dissertation an der University of Manchester vor und untersucht darin die Arbeit von evangelischen Seminaren im Großraum Madrid. Neben empirischen und kontextuellen Fragestellungen setzt sich die Autorin mit wichtigen Grundfragen der theologischen Ausbildung auseinander. Zudem bietet sie spannende Perspektiven auf das Entwicklungspotenzial und die strategische Ausrichtung von Ausbildungsstätten.
In Kapitel 1 geht es einführend um eine Definition und Verhältnisbestimmung von theologischer Ausbildung und Kontextualisierung sowie um eine methodisch sinnvolle Annäherung an den spanischen Kontext. Hierbei wertet Weaver zielgerichtet die relevante Sekundärliteratur aus und entscheidet sich u. a. für die Taxonomie von Stephen Bevans (Models of Contextual Theology, Maryknoll: Orbis, 2002) als analytisches Modell.
Im Sinne eines Critical Remembering lässt die Autorin in Kapitel 2 die Geschichte der christlichen theologischen Ausbildung etappenartig Revue passieren, um für ihre Forschung relevante Grundfragen zu priorisieren. Im Anschluss an David Goodbourn arbeitet sie dann ein vierfaches Kontinuum heraus, in dem sich Ausbildungspraxis in unterschiedlicher Form vergleichen und verorten lässt. Das besagte Kontinuum orientiert sich an folgenden Grundfragen:
(1) An wen richtet sich die Ausbildung? – an eine ausgewählte Gruppe oder an die ganze Kirche? (2) Welche pädagogische Methodologie wird verwendet? – erfahrungsorientiert oder schwerpunktmäßig kognitiv? (3) Was ist das Ziel der theologischen Ausbildung? – Zurüstung zum Dienst oder Stärkung des Glaubens? (4) In welcher ideellen oder physischen Beziehung steht die Ausbildungsstätte zur Gemeinde und zur Gesellschaft um sie herum?
Während Kapitel 3 die bewegte Geschichte der protestantischen Minderheit analysiert und den nachhaltigen Einfluss von Inquisition, Faschismus, Monarchie, Aufschwung, Säkularisierung und Migration nachzeichnet, stellt Weaver in Kapitel 4 die Ergebnisse einer Umfrage innerhalb der protestantischen Community Madrids vor. Die Gläubigen in den befragten Gemeinden erachten die formale theologische Ausbildung als wichtig, betonen aber ihre Ganzheitlichkeit, und sehen die Rolle christlicher Leiter v. a. als Ermöglicher anstatt als Alleskönner. Die Befragten bevorzugen außerdem eine theologische Ausbildung, die trotz aller Spezialisierung auch sinnvolle Angebote für Ortsgemeinden schafft. Schließlich wurde unterstrichen, dass Ausbildungsstätten gleichermaßen zur theologisch-konfessionellen Treue wie auch zur christlichen Handlungs- und Sprachfähigkeit angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen sollten.
In Kapitel 5 präsentiert Weaver ausführlich die Ergebnisse ihrer Umfragen und Interviews mit den Leitern, Lehrkräften und Studierenden von drei ausgewählten Institutionen im Großraum Madrid. Die theologischen Seminare unterscheiden sich teils stark in ihrer Geschichte und Prägung durch ausländische Missionsinitiativen, in ihrer ekklesiologischen Anbindung, in ihrem theologischen Verständnis, wie auch in der Form ihrer Kursangebote. Sie sind klassisch evangelikal bis ökumenisch protestantisch; staatlich akkreditiert bis flexibel-allgemeinbildend. Sie konzentrieren sich unterschiedlich auf die Ausbildung von Pastoren eines Gemeindebundes oder auf die Zurüstung von interessierten Laien; sie arbeiten präsentisch, hybrid oder digital-dezentral. Zudem ordnet Weaver die untersuchten Institutionen grafisch in das hilfreiche Kontinuum aus Kapitel 2 ein.
Darauf aufbauend wertet die Autorin ihre Ergebnisse in Kapitel 6 weiter aus und schlägt die Brücke zu Fragen einer sinnvollen Kontextualisierung im spanischen Kontext. Besondere Faktoren sind dabei strukturelle Entscheidungen, die beständige finanzielle Unterversorgung, die Wichtigkeit einheimischer Lehrkräfte sowie die freie Gestaltung von Lehrinhalten unabhängig von spanischen Behörden oder ausländischen Partnern. Darüber hinaus formuliert Weaver, welche Praktiken sich zur Weiterentwicklung der theologischen Ausbildung als besonders wirkmächtig dargestellt haben.
Dazu gehören die aktive Beschäftigung mit der eigenen Geschichte und mit gesellschaftlichen Entwicklungen in Spanien, die institutionelle Akkreditierung in unterschiedlichster Form als Entwicklungskatalysator, der Austausch mit den Ortsgemeinden zum gegenseitigen Vorteil, sowie die theologisch durchdachte Implementierung von positiven, kulturellen Werten und Praktiken in die Ausbildungspraxis (z. B. ermöglicht die spanische Großzügigkeit Stipendien trotz knapper Finanzen; die spanische Kaffeekultur begünstigt andere Gespräche und Lernerfahrungen als das typische Klassenraumformat). Manche Fragen bleiben offen, z. B. wie die betreffenden Ausbildungsstätten zukünftig die junge Generation zurüsten wollen, wie man lateinamerikanischen Christen besser dienen kann, und wie eine Theologie des Berufs und der Arbeit im spanischen Umfeld aussehen soll.
Wie lassen sich die Beobachtungen und Ergebnisse weiternutzen? Neben dem eigenen originären Beitrag und einem Forschungsausblick listet Weaver in Kapitel 7 zusammenfassend sechs prägende Faktoren, die Akteure in der theologischen Ausbildung grundsätzlich berücksichtigen sollten: (1) Das institutionelle Erbe, (2) der eigene historisch-kulturelle Kontext, (3) die Einsichten und Weisheit der gesamten Kirche, (4) der Einfluss demografischer Entwicklungen, (5) die Chancen und Folgen akademischer Akkreditierung, sowie (6) eine kultursensible, nach außen gewandte theologische Reflexion im Dienst der Gemeinde. Zahlreiche Grafiken und Statistiken ergänzen die Analysen; im Anhang finden sich außerdem die genutzten Fragebögen im Sinne einer Grounded Theory.
Colleen Weaver bietet eine methodisch interessante und inhaltlich anregende Studie, die kompakt und trotz mancher Wiederholungen sehr leserfreundlich geschrieben ist. Die frühere Spanien-Missionarin schafft es durchweg, die Balance zwischen Empathie und methodischer Transparenz zu halten und dabei ein hochspannendes praktisch-theologisches Forschungsprojekt voranzubringen. Besonders hervorzuheben sind die exzellenten didaktischen Vertiefungsfragen am Ende jedes Kapitels, die zum Weiterdenken und zur Diskussion anregen.
Etwas negativ fällt auf: Eine tiefere Auseinandersetzung mit relevanter Forschungsliteratur beschränkt sich vor allem auf die ersten drei Kapitel. Auch wäre eine ausführlichere und weniger indirekte Beschäftigung mit einer Theologie und Theorie christlicher Bildung interessant gewesen. Das alles schmälert jedoch keineswegs den Beitrag der Autorin insgesamt. Denn trotz des Fokus auf das protestantische Umfeld der spanischen Hauptstadt wird der Mehrwert und das Transferpotenzial ihrer Forschung überdeutlich.
Wer soll wie, wozu und wo unterrichtet werden? Hinter dieser Frage steht ein theologischer, pädagogischer und struktureller Fragenkomplex, der abseits des theologischen Tagesgeschäfts zu einem tieferen, verantwortungsvollen Reflexionsprozess drängt. Und genau dazu motiviert und leitet Weavers Studie letztlich auch an. Verantwortliche und Lehrkräfte in theologischen Ausbildungsstätten, in Gemeindebünden oder christlichen Werken werden von The Fruits of Listening zweifellos viele wertvolle Impulse mitnehmen und strategisch umsetzen können.
Daniel Vullriede, M.A., M.A., Dozent am Bibelseminar Bonn und IBEI Rom