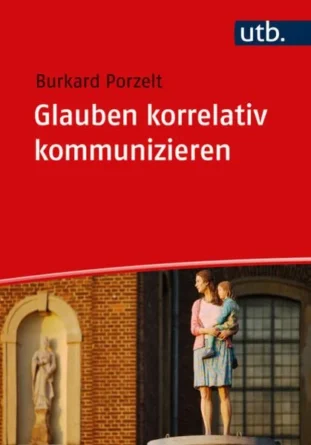Burkard Porzelt: Glauben korrelativ kommunizieren
Burkard Porzelt: Glauben korrelativ kommunizieren. Annäherungen an das religionspädagogische Korrelationsprinzip, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2023, 173 S., Pb., 19,90 €, ISBN 978-3-82526-128-3
Den christlichen Glauben verständlich, überlegt und einladend zu präsentieren, ist heutzutage keine leichte Aufgabe. Burkard Porzelt arbeitet als Professor an der Universität Regensburg und bietet mit dem vorliegenden Titel einen historisch-konzeptionellen Tiefeneinblick in die religionspädagogische Didaktik aus römisch-katholischer Sicht.
Nach einer kurzen Einführung untersucht der Autor in Kapitel 1 die Lage des konfessionellen Religionsunterrichts in der Nachkriegszeit bis zum Umbruch des Jahres 1970. Bis dahin wurde der Glaube v. a. in satzhaften Wahrheiten weitergegeben, die die christlich sozialisierten Schüler bejahen und lernen sollten. Am Beispiel des sogenannten Grünen Katechismus erläutert Porzelt das damalige neuscholastisch-kerygmatische Konzept. Dies kam angesichts einer wachsenden Kirchenskepsis und der sich stark verändernden Schullandschaft einer Einbahnstraßen-Methode gleich.
Kapitel 2 zeigt, wie die römisch-katholische Kirche bei der Würzburger Synode von 1974 auf die gesellschaftlichen Umbrüche reagierte. Die Kirchenvertreter rangen intensiv mit den Herausforderungen der sich säkularisierenden Gesellschaft und versuchten schließlich, den Sinn und den Wert des Religionsunterrichts auf drei Ebenen neu zu begründen (kulturgeschichtlich, anthropologisch, ideologiekritisch).
Kapitel 3 beleuchtet zusätzliche Etappen, bei denen das religionspädagogische Korrelationsprinzip weitergedacht wurde: Dazu gehören der Zielfelderplan für die Grundschule von 1977, die Brixener Tagung von 1979 sowie der Grundlagenplan für die Sekundarstufe I von 1984. Der Autor zeichnet damalige Entwicklungen nach, analysiert offizielle Tagungsdokumente, lässt prägende Stimmen zu Wort kommen und wertet repräsentative Schulbücher aus.
Einerseits wird das größere Anliegen deutlich, dass guter Religionsunterricht theologisch und pädagogisch durchdacht, aber auch didaktisch sinnvoll durchgeführt werden sollte. Andererseits will der Autor mit seinen Ausführungen verhindern, dass die Korrelationsdidaktik zu einem Containerbegriff oder einem Tool degradiert wird, bei dem man Bibeltexte entstellt oder moderne Fragen bloß als Köder für eine lebensferne Katechese nutzt. Stattdessen geht es Porzelt um die Wechselseitigkeit von Glauben und Erfahrung. In Kapitel 4 geht er zusätzlich auf Kritik ein, die konservative und progressive Denker im Laufe der Zeit an der korrelativen Idee geäußert haben.
Zentral ist das Kapitel 5: Porzelt spielt hier konzeptionell konkret durch, wie man die Glaubens- und Lebenserfahrungen von Schülern im Religionsunterricht sinnvoll ins Spiel bringen könnte. Der Religionspädagoge präsentiert dazu ein simples lebens-hermeneutisches Modell, bei dem individuelle Erlebnisse gedeutet und erst auf diese Weise zu persönlichen Erfahrungen werden. Ebenso betont er, wie wichtig menschliche Grunderfahrungen seien und als Brücke fungierten, um trotz unterschiedlicher Weltbilder überhaupt gemeinsam ins Gespräch zu kommen. So kommt er zu folgenden Kernthesen:
- „Lebensbedeutsame Erfahrungen aus christlicher Überlieferung und heutigen Lebenswelten stehen sich im Religionsunterricht ebenbürtig gegenüber.“ (134)
- „Gemeinsame anthropologische Grunderfahrungen, die das Trennende nicht verschleiern, bilden das verbindende ‚Dritte‘ des korrelativen Dialogs.“ (137)
- „Verbindende Grunderfahrungen sind in überlieferten und aktuellen Erfahrungszeugnissen aufzuspüren und aufzuweisen.“ (ebd.)
- „Die Respektierung der jeweiligen Eigenart und Vielfalt sowie der gegenseitigen Fremdheit von Glaubens- und Lebenserfahrungen ist Grundlegung für einen wahrhaftigen Erfahrungsdialog.“ (139)
- „Überlieferte und gegenwärtige Erfahrungszeugnisse müssen nicht harmonisierend auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden.“ (141)
- „Die indirekte Widerspiegelung von Gegenwartserfahrungen ermöglicht eine behutsame Kommunikationskultur.“ (145)
Der Religionsunterricht könne letztlich ein „spannender und vielstimmiger Erfahrungsdialog“ (152) werden, gerade weil die menschlichen Erfahrungen, von denen die Bibel zeugt, mit den Erfahrungen von Gläubigen in der Geschichte und im Heute mit jenen Erfahrungen säkularer Menschen wie auch anderer Religionen in einen lebendigen Austausch eintreten könnten.
Hier zeigt sich das pädagogische Anliegen des Autors: Das so gestaltete Unterrichtsfach „gleicht einer Expedition, die den Lernenden verschiedenste Optionen zugänglich macht, wie Menschen ihr Dasein verankern und deuten können.“ (154) Dabei ist die junge Generation „angespornt und aufgefordert, das, was ihnen auf dieser Entdeckungsreise begegnet, wahr- und aufzunehmen, um sich schließlich selbst einen begründeten Reim darauf zu machen – angesichts der ihnen aufgetragenen Aufgabe, ihr Leben zu bewältigen und zu deuten.“ (ebd.) Ein nützlicher Anhang rundet den Titel ab.
Der historische Ansatz des Buches mag anfangs etwas dröge wirken, doch erfüllt er seinen Zweck gut. Der Autor schreibt flüssig und logisch, kritisch und geistreich. Zahlreiche Grafiken verhelfen zum tieferen Verständnis und laden ein, nicht bloß eine didaktische Technik zu erlernen, sondern ein gewichtiges didaktisches Modell kontextuell zu verstehen und weiterzudenken. Wie schon in früheren Veröffentlichungen (vgl. Porzelt: Grundlegung religiöses Lernen, 2013) sensibilisiert der Autor für eine solide Pädagogik in Theorie und Praxis sowie für die gesellschaftlichen und schulischen Rahmenbedingungen, mit denen Religionspädagogen arbeiten müssen. Dabei hofft er im Grunde nüchtern-optimistisch auf den unverfügbaren „Versuch des Verstehens“ (139), der in manchen Sternstunden des Unterrichts von Erfolg gekrönt ist, was kurz an die neuere Resonanzpädagogik erinnert.
Aus einer evangelikalen Sicht fällt das spannungsreiche Ringen des Autors mit der römisch-katholischen Kirche auf, die sich als institutionell-autoritative Bewahrerin der ihr anvertrauten Glaubenswahrheiten in Bibel und Tradition versteht und dennoch dem Heute begegnen muss. Abgesehen von dem unterschiedlichen Offenbarungsverständnis werden manche Leser eventuell das anthropologische Axiom anders betonen und den existenziellen Erfahrungsbegriff metaphysisch noch stärker öffnen wollen, zudem andere Akzente in einem christlichen Kulturverständnis post lapsum setzen (vgl. Watkin: Biblical Critical Theory, 2022).
Am Ende lädt Porzelt seine Leser nicht nur ein, die Bereiche von Theologie, Pädagogik und Didaktik sinnvoll miteinander zu verbinden. Er vermittelt darüber hinaus ein echtes Anliegen für die junge Generation und unterstreicht die Relevanz des christlichen Glaubens in einer säkularen, pluralistischen Gesellschaft. Die große Frage nach einem dritten Weg, d. h. abseits von einseitiger Progressivität und starrem Traditionalismus, bleibt eine der großen Herausforderung, mit der auch protestantische Pädagogen zukünftig weiter ringen werden.
Daniel Vullriede, M.A., M.A., Dozent am Bibelseminar Bonn und IBEI Rom